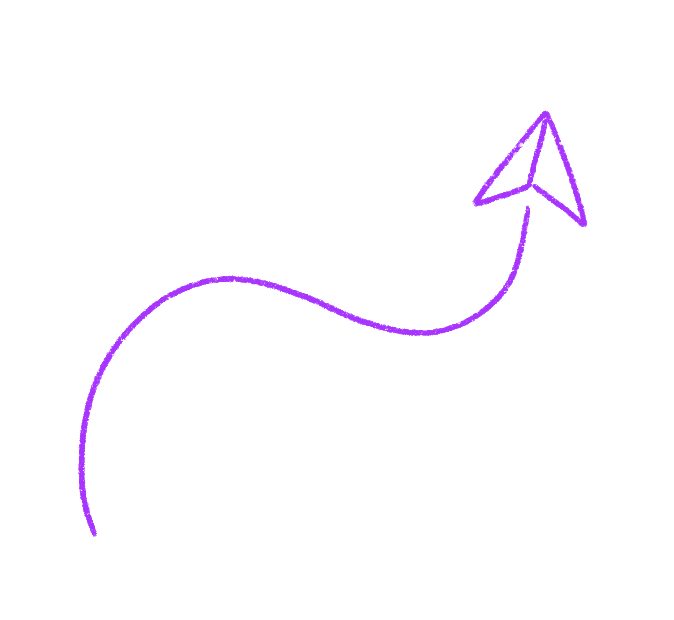Degenerative Zerebrale Krankheit
Eine Degenerative Zerebrale Krankheit kennzeichnet Erkrankungen, die das Gehirn nachhaltig schädigen. Darunter zählt zum Beispiel auch eine Form der Demenz.
Delir
Demenz
Merkmale
Das Hauptmerkmal einer Demenz ist die Entwicklung unterschiedlicher kognitiver Defizite. Die Beeinträchtigungen betreffen neben der Gedächtnisstörung auch andere Bereiche, wie das Denken, die Orientierung, die Sprache (Aphasie), das Urteilsvermögen, die Lernfähigkeit, das Rechnen, die Ausführung zielgerichteter motorischer Bewegungen (Apraxie), eine Unfähigkeit Dinge wiederzuerkennen (Agnosie) sowie die exekutiven Funktionen, d.h. Planen, Organisieren oder Einhalten einer logischen Reihenfolge.
Gedächtnisstörung
Die Gedächtnisstörung betrifft charakteristischerweise die Aufnahme, das Speichern und die Wiedergabe neuer Informationen, also Funktionen des Kurzzeitgedächtnisses. In späteren Krankheitsstadien einer Demenz kann auch das Langzeitgedächtnis betroffen sein, was sich durch einen Verlust von früher gelerntem oder bekanntem Material zeigt. Die ersten auffälligen Anzeichen der Vergesslichkeit sind das Verlieren persönlicher Gegenstände, wie der Brieftasche, das Vergessen von Speisen auf dem Herd oder das Vergessen von Terminen und Verabredungen. Die Gedächtnisstörung kann so schwer sein, dass die von Demenz betroffene Person biographische Informationen, wie ihren Beruf, ihren Geburtstag oder sogar ihren eigenen Namen vergisst und sich nicht an Familienangehörige erinnern kann. Oftmals haben Betroffene Schwierigkeiten sich zu orientieren, in späteren Krankheitsstadien sogar in einer bekannten Umgebung, wie der eigenen Wohnung.
Sprache
Sprachliche Beeinträchtigungen können sich durch die Schwierigkeit zeigen, Personen oder Dinge zu benennen. Ebenso können Betroffene Probleme haben, gesprochene und geschriebene Sprache zu verstehen oder diese zu wiederholen. In späteren Stadien der Demenz kann Stummheit auftreten oder ein Sprachmuster, bei dem Betroffene nur das nachsprechen, was sie hören (Echolalie) oder einzelne Wörter oder Klänge ständig wiederholen (Palilalie).
Motorik
Eine Apraxie (also die beeinträchtigte Fähigkeit zielgerichtete motorische Fähigkeiten auszuführen, obwohl die Motorik, Sensorik und das Aufgabenverständnis nicht gestört sind) kann sich beispielsweise beim Haarekämmen, Kochen oder Anziehen zeigen.
Urteilsvermögen
Die Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und der Einsichtsfähigkeit kann sich darin äußern, dass Betroffene beispielsweise unpassende Kleidung anziehen (z.B.Wintermantel im Sommer), völlig unrealistische und angesichts ihrer Prognose inadäquate Pläne schmieden (z.B. neue Geschäftsideen) oder Risiken (z.B. Autofahren) unterschätzen. Die Verschlechterung der Lernfähigkeit zeigt sich beispielsweise im Unvermögen neue Dinge wie ein Spiel oder eine Sprache zu lernen. Probleme beim Rechnen zeigen sich im Alltag beim Einkaufen oder beim Prüfen von Rechnungen. Auch die Entwicklung einer Agnosie (eingeschränkte Fähigkeit Objekte zu identifizieren, obwohl die Sensorik nicht gestört ist) ist bei einer Demenz häufig und äußert sich dadurch, dass Betroffene irgendwann selbst bekannte, alltägliche Gegenstände wie einen Stuhl oder Besteck nicht wiedererkennen. In späten Krankheitsstadien können sogar Familienmitglieder oder das eigene Spiegelbild nicht mehr erkannt werden.
Exekutivfunktionen
Auch das Erkennen von Gegenständen durch Berührung oder Ertasten (z.B. Schlüssel) kann gestört sein, obwohl die taktile Reizverarbeitung an sich nicht gestört ist. Die Exekutivfunktionen umfassen höhere kognitive Denkprozesse, wie das Setzen von Zielen, die Entscheidung für Prioritäten, die Impulskontrolle, die Aufmerksamkeitssteuerung sowie das Planen, Beginnen, Fortführen, Kontrollieren und die Unterbrechung von zielgerichteten Handlungen. Betroffene haben Probleme damit, komplexe Aufgaben oder Handlungen zu bewältigen, den geistigen Bezugspunkt zu wechseln oder Bewegungen in einer festgelegten Reihenfolge auszuführen.
Persönlichkeit
Neben der Beeinträchtigung der kognitiven Funktionen zeigen von Demenz betroffene Personen meist Veränderungen ihrer Persönlichkeit und im emotionalen und sozialen Bereich. So kann eine reduzierte Motivation, enthemmtes oder aggressives Verhalten, Vernachlässigung der Körperpflege, sozial unangepasstes Verhalten, sozialer Rückzug und Desinteresse auftreten. Daneben kommt es zu Schwierigkeiten die persönlichen alltäglichen Anforderungen, wie Waschen, Ankleiden, Kochen, Essen, persönliche Hygiene und Benutzung der Toilette, zu erfüllen.
Eine Demenz tritt häufig in Kombination mit Angststörungen, affektiven Störungen oder Schlafstörungen auf. Nicht selten treten Wahnvorstellungen (besonders Verfolgungswahn) und Halluzinationen (besonders optische Halluzinationen) auf. Bei der Demenz finden sich keine qualitativen Bewusstseinsstörungen (der Betroffene ist also bei vollem Bewusstsein), es sei denn ein Delir überlagert die dementielle Erkrankung – was häufig der Fall ist. Eine Demenzerkrankung erhöht darüber hinaus die Empfindlichkeit auf körperliche und psychosoziale Belastungen (z.B. Operation oder Einweisung ins Krankenhaus).
Verlauf
Der Begriff Demenz impliziert einen fortschreitenden, irreversiblen Verlauf, sie kann jedoch auch in einem bestimmten Stadium stehenbleiben oder zurückgehen. Der Beginn und der Verlauf einer Demenz hängen von der ursächlichen Erkrankung und einer rechtzeitigen Behandlung ab. Wie schwer Betroffene im Alltag beeinträchtigt sind hängt zudem, neben dem Ausmaß der kognitiven Störungen, maßgeblich von der sozialen Unterstützung ab. In späteren Krankheitsstadien besteht meist eine starke Pflegebedürftigkeit.
Zahlen
Studien zur Prävalenz der Demenz in Deutschland und anderen Industrienationen fanden Zahlen zwischen 6% und knapp 9% der über 65-Jährigen. Davon leiden zwei Drittel an einer Demenz des Alzheimer-Typus, gefolgt von der vaskulären Demenz. Nicht selten treten beide Krankheitsfaktoren gemeinsam auf. Unter 65 Jahren sind nur 3% an einer Demenz erkrankt, während die Häufigkeit bei den über 90-Jährigen auf über 30% ansteigt.
Subtypen der Demenz
Eine Demenz kann verschiedene medizinische Krankheitsfaktoren als Ursache haben:
- Demenz bei der Alzheimer-Krankheit (primär degenerative zerebrale Krankheit mit unbekannter Ätiologie)
- Vaskuläre Demenz (einschließlich Multiinfarkt-Demenz; Demenz entwickelt sich als Folge einer vaskulären Krankheit)
- bei anderen Krankheiten (u.a. Pick-Krankheit, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, Chorea Huntington, Parkinson-Syndrom, HIV-Krankheit)
- Demenz bei anderen Krankheitsfaktoren, wie strukturelle Schädigungen (z.B. Hirntumor), endokrine Faktoren (z.B. Schilddrüsenunterfunktion), ernährungsbedingte Faktoren (z.B. Vitamin B12 Mangel), infektiöse Erkrankungen (z.B. Neurosyphilis) und neurologische Erkrankungen (wie z.B. Multiple Sklerose)
Therapie
Die Therapie der Demenz sollte aus einer Kombination aus medikamentöser und nicht medikamentöser Behandlung bestehen.
Wichtige Grundsätze der nichtmedikamentösen Behandlung sind die geistige und körperliche Forderung der Patienten und ein verständnis- und respektvoller Umgang mit den Kranken. Ziel der Forderung (nicht Überforderung!) ist es, die Selbstständigkeit des Patienten so lange wie möglich zu erhalten. Um die Beweglichkeit zu fördern, hat sich leichtes Bewegungstraining als günstig erwiesen. Genauso können Aktivitäten wie Wandern, Spazierengehen, Schwimmen, Tanzen oder fernöstliche Methoden wie Qigong oder Tai Chi förderlich sein. Der geistige Abbau kann z.B. durch Lesen oder Gespräche verzögert werden. Der an Demenz Erkrankte sollte so lange wie möglich in das alltägliche Leben und Entscheidungen miteinbezogen werden.
Bei voranschreitender Beeinträchtigung im kognitiven Bereich und Veränderung der Persönlichkeit ist es besonders wichtig respektvoll und wertschätzend mit dem Erkrankten umzugehen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Demenzkranke brauchen viel emotionale Zuwendung, Sicherheit und Stabilität, da der Abbauprozess für die Betroffenen sehr beängstigend und verunsichernd sein kann.
Die Validationsmethode nach Feil hat sich als sehr günstig im Umgang mit an Demenz Erkrankten erwiesen. Die Methode zielt darauf ab, dass man als Pflegender die Realität des Erkrankten annimmt, auch wenn es manchmal schwer fällt, bestimmte Verhaltensweisen oder Reaktionsweisen nachzuvollziehen. Die Methode vermittelt, dass die Gefühle und das Verhalten des Kranken „für gültig erklärt“ und wertgeschätzt werden sollen.
Depersonalisation
Die Depersonalisation bezeichnet einen psychischen Zustand bzw. eine bestimmte Form von psychischer Störung, bei dem eine Veränderung der Persönlichkeit erlebt wird. Betroffene empfinden ihre eigenen Gefühle, ihren Körper, ihre Wahrnehmungen, ihre Erinnerung, ihr Denken und Handeln als fremd, losgelöst, verloren und fern.
Dies tritt z.B. bei der Borderline-Störung auf.
Interessante Links
ze.tt: Wenn du plötzlich nicht mehr du selbst bist, weil du gekifft hast
Depression
Merkmale der Depression
Personen, die an einer Major Depression leiden, zeigen über mindestens zwei Wochen lang an fast allen Tagen und über die meiste Zeit des Tages hinweg eine depressive, niedergeschlagene Stimmung und Interessenlosigkeit. Außenstehende können ihnen ansehen, dass sie traurig, hoffnungslos und deprimiert sind. Häufig kann es auch zu einer erhöhten Reizbarkeit, in Form von Jähzorn, Ärger, Schuldzuweisungen und einer niedrigen Frustrationstoleranz kommen. Betroffene verlieren die Freude an ihren Hobbys, oder anderen Aktivitäten, die sie früher gerne gemacht haben. Sie ziehen sich aufgrund der Depression sozial zurück und ihr Interesse an sexuellen Tätigkeiten oder Fantasien schwindet immer mehr.
Essverhalten
Zusätzlich können sich Auffälligkeiten im Appetit und Gewicht manifestieren. Depressive Personen müssen sich entweder regelrecht dazu zwingen etwas zu essen oder sie können einem Heißhunger auf Süßigkeiten oder anderen Nahrungsmitteln unmöglich wiederstehen. Nachts neigen Depressive dazu aufzuwachen und nicht mehr einschlafen zu können oder sie wachen morgens schon Stunden vor ihrer normalen Aufwachzeit auf. Eher selten zeigt sich das Bild einer Hypersomnie.
Unruhe
Des Weiteren fällt bei depressiven Personen auf, dass sie kaum in der Lage sind still zu sitzen. Sie gehen unentwegt auf und ab, reiben oder zupfen an der Haut, an ihrer Kleidung oder an anderen Gegenständen. Andererseits kann sich aber auch eine psychomotorische Verlangsamung ausbilden. So erscheinen Betroffene äußerst gehemmt beim Sprechen, beim Denken und in ihren Bewegungen. Antworten brauchen länger und die Sprache ist leise, monoton und mit wenig Abwechslung. Personen mit einer Depression haben Probleme sich zu konzentrieren, tun sich schwer Entscheidungen zu treffen, wirken eher zerstreut und klagen über Gedächtnisschwierigkeiten. Typischerweise fühlen sich Personen mit einer Major Depression selbst nach kleinsten Aufgaben übermäßig erschöpft. Sie brauchen länger, um etwas zu erledigen und schaffen es dabei kaum, die Aufgaben ordnungsgemäß auszuführen. Für das tägliche Waschen und Anziehen brauchen sie meist doppelt so lang wie normal.
Selbstwertgefühl
Zudem plagen sie Gefühle der eigenen Wertlosigkeit und Schuld. Sie machen sich Vorwürfe wegen kleinen Fehlern oder Ereignissen in der Vergangenheit. Nicht selten kommt es bei einer Depression zu immer wieder auftretenden Gedanken an den Tod bzw. Versuchen sich das Leben zu nehmen. Betroffene sind dann der Meinung, dass der eigene Tod für die Mitmenschen eine Erleichterung und für sie selbst eine Erlösung, von einem endlos andauernd wahrgenommenen schmerzhaften Gefühlszustand, wäre.
Damit von einer depressiven Störung gesprochen werden kann, müssen die Betroffenen massiv unter den Symptomen leiden oder in ihren sozialen, beruflichen oder anderweitigen Funktionsbereichen deutlich eingeschränkt werden. So kann es zu einem Verlust des Arbeitsplatzes, Problemen in engen Beziehungen und Partnerschaften (Scheidung), sexuellen Problemen oder einem Missbrauch von Alkohol oder anderen Substanzen kommen. Personen mit einer Major Depression klagen häufig über Kopf-, Gelenk-, Bauch- oder andere Schmerzen und können Panikattacken ausbilden. Bei schweren Formen einer depressiven Störung schaffen es betroffene Personen nicht, sich selbst zu versorgen oder eine minimale persönliche Hygiene beizubehalten.
Andere Störungen
Die Major Depression tritt häufig zusammen mit anderen psychischen Störungen auf, so z.B. mit substanzinduzierten Störungen, einer Panikstörung, einer Zwangsstörung, einer Anorexia Nervosa, einer Bulimia Nervosa oder einer Borderline Persönlichkeitsstörung.
Bei der dysthymen Störung liegt eine chronisch depressive Verstimmung für mindestens zwei Jahre an den meisten Tagen vor. Betroffene beschreiben ihre Stimmung als traurig oder niedergeschlagen. Außerdem leiden sie an vermindertem Appetit oder übermäßigem Essensdrang, Schlaflosigkeit oder verstärktes Bedürfnis nach Schlaf, einem Energiemangel oder Erschöpfung, einem erniedrigten Selbstwertgefühl, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und zu entscheiden oder dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Das Störungsbild der Dysthymie kann in Verbindung mit der Borderline, der histrionischen, der narzisstischen, der ängstlich-vermeidende und der abhängigen Persönlichkeitsstörung oder auch mit einer Substanzabhängigkeit auftreten.
Verlauf
In der Regel entwickeln sich die Symptome einer Major Depression über einige Tage oder Wochen. Manche Personen zeigen einen schleichenden Beginn innerhalb von einigen Wochen oder Monaten – die sogenannte Prodromalphase – in der die Symptome nur in leichter Ausprägung vorhanden sind. In der Mehrzahl der Fälle gehen die depressiven Symptome vollständig zurück. Bei ungefähr 20 bis 30% halten sich ein paar Restsymptome über Monate oder Jahre hinweg.
Im Verlauf eines Lebens können nur eine einzige (welche generell um die 4 Monate oder länger andauert) oder mehrere Episoden einer Major Depression vorkommen. 5 bis 10% der Betroffenen zeigen einen chronischen Verlauf. Manche zeigen vereinzelte depressive Episoden mit jahrelangen Intervallen ohne Symptome, andere entwickeln mit zunehmendem Alter häufigere Episoden und kürzere Intervalle ohne Symptome. Dabei gilt eine Episode der Major Depression als abgeschlossen, wenn der Betroffene innerhalb von mindestens zwei Monaten symptomfrei ist.
Haben Menschen eine einzelne Episode einer Major Depression durchlebt, dann besteht eine 60%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie an einer weiteren Episode erkranken. Nach zwei depressiven Episoden erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer dritten auf 70%, bei drei auf 90%. Bei ungefähr 5-10% der Betroffenen tritt nach einer einzelnen Episode einer Major Depression anschließend eine manische Episode (Manie) auf.
Eine Major Depression ist in jedem Alter möglich. Das durchschnittliche Ersterkrankungsalter liegt jedoch zwischen dem zwanzigsten und dreißigsten Lebensjahr. In den letzten Jahrzehnten zeigt sich der Beginn einer Major Depression immer früher. Personen mit einer Major Depression sind unter anderem suizidgefährdet. Bis zu 15% der Betroffenen nehmen sich das Leben. In der Altersgruppe der über 55-Jährigen hat sich eine viermal so hohe Mortalitätsrate (Anzahl der Todesfälle im Verhältnis zur Bevölkerung) gezeigt.
Die dysthyme Störung zeigt oftmals einen frühen (d.h. in der Kindheit, in den Jugendjahren oder im frühen Erwachsenenalter), schleichenden Beginn und nimmt in der Regel einen chronischen Verlauf.
Zahlen
Die Wahrscheinlichkeit an einer Major Depression zu erkranken liegt bei Frauen aus der Allgemeinbevölkerung zwischen 10 und 25% und für Männer zwischen 5 und 12%. Zur Zeit leiden Schätzungen zufolge ca. 5-9% aller Frauen und 2-3% aller Männer an einer Depression. Die Prävalenzraten scheinen unabhängig von der ethnischen Herkunft, dem Bildungsgrad, dem Einkommen und dem Familienstand zu sein.
An einer dysthymen Störung leiden zwei bis dreimal mehr Frauen als Männer und die Lebenszeitprävalenz liegt bei ca. 6%. Im Moment leiden ca. 3% an einer Dysthymie. Frauen weisen gegenüber Männern ein deutlich höheres Risiko auf, irgendwann im Leben eine depressive Episode zu entwickeln. Einige berichten, dass sich die Symptome ein paar Tage vor der Menstruation verschlechtern. Depressive Episoden treten bei Frauen zweimal häufiger als bei Männern auf.
Subtypen
Für das Störungsbild der Depression werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Depressionen sind häufig Gegenstand einer psychotherapeutischen Behandlung, da die affektive Störung nicht nur für sich alleine auftritt. Viele Menschen mit einer anderen psychischen Störung leiden zusätzlich an einer Depression.
Psychoanalytische Therapie
In der psychoanalytischen Therapie versucht der Therapeut den depressiven Klienten dabei zu unterstützen, unbewusste Trauererlebnisse über reale oder vorgestellte Verlusterlebnisse wieder bewusst zu machen und zu überwinden. Dabei sollen die Betroffenen auch ihre übermäßige Abhängigkeit von anderen Menschen ablegen. So kommen Methoden wie freie Assoziation, Traumdeutung, Aufdeckung von Widerständen und Übetragungsversuchen und das Wiedererleben von vergangenen Ereignissen und Gefühlen zum Einsatz.
Im Laufe der Therapie einer Depression soll der Klient dazu befähigt werden, allmählich unabhängiger von anderen zu sein, mit Verlusten besser umzugehen und sein Alltagsleben wieder meistern zu können. Diese Form der Therapie hat sich in der Forschung als eingeschränkt wirksam bei Depressionen erwiesen, da sich Patienten oft zu energielos fühlen, um sich am Therapiegeschehen aktiv zu beteiligen. Meist dauert ihnen das Verfahren auch zu lange, bis sich endlich eine Besserung der Symptome einstellt. Eine psychoanalytische Kurzzeittherapie hat sich für die Behandlung einer Depression als sinnvoller erwiesen.
Kognitive Verhaltenstherapie
Die kognitive Verhaltenstherapie hat sich als äußerst wirksam bei der Behandlung der Major Depression gezeigt. So versucht ein Ansatz nach Peter Lewinsohn die fehlende positive Verstärkung im Leben der Patienten wieder zurückzuerlangen. Bei der Behandlung werden die Personen mit einer Depression wieder mit Ereignissen und Aktivitäten vertraut gemacht, die sie einmal als angenehm empfanden. Sie werden systematisch für nicht-depressives Verhalten verstärkt bzw. belohnt und in ihren interpersonalen Fertigkeiten trainiert.
Bei der kognitiven Therapie der Depression nach Aaron Beck geht man davon aus, dass die affektive Störung das Ergebnis einer Kette kognitiver Fehler ist. Depressive Menschen neigen zu fehlangepassten Einstellungen, die zu einer negativen Sichtweise der eigenen Person, der Welt im Allgemeinen und der eigenen Zukunft führen. Die verzerrte Sichtweise manifestiert sich in anhaltenden negativen Gedanken, die das Bewusstsein überfluten und die depressiven Symptome hervorrufen. In der Therapie versucht der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten, die dysfunktionalen Denkprozesse aufzudecken und zu verändern. Dadurch soll sich die Stimmung wieder aufhellen und das Verhalten normalisieren. Bei etwa 50 bis 60% der kognitiv behandelten Betroffenen gehen die depressiven Symptome vollständig zurück. Die Therapie wird auch als Gruppentherapie angewandt.
Seit den 1950er Jahren werden auch Antidepressiva erfolgreich bei der Behandlung der Depression eingesetzt.
Derealisation
Die Derealisation bezeichnet einen psychischen Zustand bzw. eine bestimmte Form von psychischer Störung, bei dem eine Person die Objekte, Menschen oder ihre Umgebung als unwirklich, künstlich, farblos, leblos usw. wahrnimmt.
Differenzialdiagnose
Treten bei einer Erkrankung ähnliche Symptome auf, die auch auf eine andere Erkrankung hindeuten können, muss mittels einer Differenzialdiagnose in beide Richtungen untersucht werden, um eine eindeutige Diagnose stellen zu können.
Dissoziative Amnesie
Merkmale
Die Dissoziative Amnesie führt bei betroffenen Personen dazu, dass sie nicht in der Lage sind, sich an wichtige, kurz zurückliegende Ereignisse bzw. Aspekte der persönlichen Lebensgeschichte zu erinnern. Meist stehen die Erinnerungslücken in Zusammenhang mit traumatischen oder extrem belastenden Situationen, allerdings sind es in der Regel reversible (umkehrbare) Beeinträchtigungen des Gedächtnisses.
Die Erinnerungsausfälle bei einer dissoziativen Amnesie können nicht durch gewöhnliche Vergesslichkeit oder Müdigkeit erklärt werden. Auch werden sie nicht durch die Wirkung einer Substanz oder eine neurologische bzw. medizinisch relevante Krankheit hervorgerufen. Betroffene leiden entweder stark unter der Symptomatik oder werden in ihrem sozialen, beruflichen oder einem anderen wichtigen Lebensbereich negativ beeinflusst. Das Verhalten kann von einer Ratlosigkeit, einem gequälten Gefühlserleben, ziellosem Umherwandern und aufmerksamkeitssuchenden Reaktionen bestimmt sein.
Zusätzlich zur dissoziativen Amnesie können Betroffene depressive Symptome, Trancezustände, sexuelle Funktionsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, selbstverletzendes Verhalten und aggressive sowie suizidale Impulse aufweisen.
Weitere Informationen zu den verschiedenen psychischen Erkrankungen erhalten Sie im Bereich Wissen auf psycheplus.
Verlauf
Die dissoziative Amnesie kann in jeder Altersstufe auftreten. Die rückblickend berichteten Erinnerungslücken können von Minuten bis hin zu Jahren dauern. Es kann im ganzen Lebensverlauf nur eine Episode des Vergessens auftreten oder auch mehrere. Ist jedoch eine Episode einer dissoziativen Amnesie schon einmal aufgetreten, so erlebt der Betroffene mit höherer Wahrscheinlichkeit auch eine weitere. Es ist möglich, dass eine akut eintretende Amnesie spontan wieder zurückgeht, wenn die betroffene Person nicht mehr mit der belastenden Situation konfrontiert wird. Selbst bei einer chronischen Amnesie kann ein Betroffener die Erinnerung allmählich wieder zurückerlangen.
Zahlen
In den letzten Jahrzehnten haben sich die Fälle von Erinnerungsverlust von frühkindlichen Traumata gehäuft. Manche klinischen Forscher sind der Meinung, dass die größere Aufmerksamkeit für die Diagnose dissoziative Amnesie dazu führte, dass mehr Fälle erkannt wurden. Genaue Zahlen zu den Prävalenzraten liegen psycheplus zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Einige Studien weisen darauf hin, dass die dissoziative Amnesie bei Personen im jungen Erwachsenenalter am häufigsten auftritt.
Dissoziative Amnesie – Subtypen
Bei der dissoziativen Amnesie werden fünf verschiedene Unterkategorien unterschieden.
Personen mit einer lokalisierten Amnesie können sich nicht mehr an Ereignisse während eines bestimmten Zeitintervalls erinnern, meistens nicht einmal mehr an die ersten Stunden des Ereignisses.
Die selektive Amnesie verhindert die Erinnerung an einige, aber nicht alle Ereignisse während eines Zeitintervalls und eventuell vergessen die Betroffenen auch nur äußerst belastende Aspekte.
Zu den eher selten auftretenden Typen zählt die generalisierte Amnesie, bei der das gesamte Leben in Vergessenheit gerät.
Bei der kontinuierlichen Amnesie werden alle Ereignisse ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit bis in die Gegenwart hinein nicht mehr erinnert.
Bei der systematisierten Amnesie werden nur bestimmte Aspekte von Informationen verdrängt.
Therapie
In der Regel behandeln Therapeuten die dissoziative Amnesie mit psychoanalytischen Therapien. Der Patient soll frei assoziieren und in sein Unbewusstes vordringen. Man versucht mit diesen Techniken die vergessenen Erfahrungen wieder bewusst werden zu lassen. Generell sind psychoanalytische Therapeuten darum bemüht, verdrängte Erinnerungen und andere psychische Prozesse wieder aufzudecken. Damit kommen sie dem Bedürfnis der Amnesie-Betroffenen entgegen. Allerdings gibt es noch keine kontrollierte Überprüfung des Behandlungserfolgs.
Neben den psychoanalytischen Ansätzen kommt auch die Hypnosetherapie (hypnotische Therapie) bei der dissoziativen Amnesie zum Einsatz. Der Therapeuten hypnotisiert hier den Patienten und hält ihn dazu an, sich die vergessenen Ereignisse ins Gedächtnis zurückzurufen. Es ist bereits bekannt, dass Personen mit einer dissoziativen Störung äußerst suggestibel sind und sich deshalb auch leicht in Hypnose versetzen lassen.
Dissoziative Bewegungsstörung
Merkmale
Personen, die an einer dissoziativen Bewegungsstörung leiden, weisen Symptome oder Ausfälle von willkürlichen motorischen Abläufen auf, die zwar eine neurologische oder somatische Störung vermuten lassen, doch legen körperliche Untersuchungen eine psychische Ursache nahe. Sie werden von den Betroffenen weder absichtlich erzeugt noch vorgetäuscht.
Am häufigsten verlieren Betroffene die komplette oder nur einen Teil ihrer Bewegungsfähigkeit von einem oder mehreren Körperteilen. Sie können Probleme bei der Koordination (Ataxie), vor allem der Beine oder beim Gleichgewicht halten aufweisen. Sie können Lähmung unterschiedlicher Ausprägung von schwach (nur einzelne Teile sind betroffen) bis stark (alle Körperteile sind betroffen) ausbilden. Somit kann es fast unmöglich sein, eigenständig zu stehen (Astasie) oder zu gehen (Abasie). Außerdem können bei dissoziativen Bewegungsstörungen Beschwerden beim Schlucken oder ein Kloßgefühl im Hals auftreten. Nicht selten kann es bei Betroffenen auch zu einem auffälligen Zittern oder Schütteln der Arme oder Beine oder gar des ganzen Körpers kommen. Um von einem psychischen Krankheitsbild sprechen zu können, müssen die Bewegungsstörungen erhebliches Leiden bzw. soziale, berufliche oder sonstige Beeinträchtigungen mit sich ziehen.
Des Weiteren können Betroffene auch an anderen dissoziativen Störungen, an einer Depression oder an einer histrionischen, antisozialen, Borderline oder abhängigen Persönlichkeitsstörung leiden.
Informieren Sie sich über weitere psychische Erkrankungen im Wissenbereich auf psycheplus.
Verlauf
psycheplus liegen im Moment keine detaillierten und fundierten Beschreibungen zum charakteristischen Verlauf der dissoziativen Bewegungsstörung vor.
Für gewöhnlich beginnen Konversionsstörungen plötzlich in der späten Kindheit und im jungen Erwachsenenalter. Die einzelnen Symptome können sich im Laufe der Zeit verstärken, dauern aber generell nicht lange an, d.h. sie gehen meist innerhalb von 2 Wochen wieder zurück. Jedoch können die Symptome immer wieder kommen – bei 20 bis 25% der Betroffenen bereits innerhalb eines Jahres. Falls die Symptome akut beginnen, eine Belastung vor dem Beginn klar ausgemacht werden kann und eine Behandlung der Symptomatik schnell erfolgt, stehen die Chancen gut, dass die Konversionsstörung erfolgreich therapiert werden kann.
Zahlen
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen psychplus keine genauen Prävalenzschätzungen zur dissoziativen Bewegungsstörung vor.
In der Regel kommen Konversionsstörungen jedoch eher in ländlichen Gegenden bzw. in Entwicklungsregionen vor und bei Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status. Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz für Konversionsstörungen in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen bei ca. 3%. In der Allgemeinbevölkerung liegt der Wert wesentlich niedriger, bei ca. 0,0001%.
Frauen bilden 2 bis 10mal häufiger eine Konversionsstörung aus als Männer. Oft tritt eine Konversionsstörung bei Männern nach einem Arbeitsunfall oder dem Wehrdienst auf.
Subtypen
Beim Störungsbild der dissoziativen Bewegungsstörung werden keine Subtypen unterschieden.
Dissoziative Bewegungsstörung – Therapie
Können mögliche körperliche Ursachen für die auftretenden Symptome definitiv ausgeschlossen werden, kann von einer Konversionsstörungen ausgegangen werden. In der Therapie widmet man sich zunächst einmal den Befürchtungen des Patienten, an einer bedrohlichen körperlichen Erkrankung zu leiden oder „verrückt“ zu werden. Therapeuten beruhigen Betroffene, in dem sie Informationen liefern, dass das Störungsbild in der Regel ungefährlich ist.
Bei der eigentlichen Behandlung der Symptome einer Konversionsstörung versuchen Therapeut und Patient gemeinsam die situativen Auslöser zu finden und zu beschreiben. Es können sich dabei unverarbeitete Traumatisierungen, Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch in der Kindheit oder weitere Belastungen als Ursache herauskristallisieren. Diese werden therapeutisch so lange bearbeitet, bis verdrängte Scham- oder Schuldgefühle in ein konsistent bejahendes Selbstbild integriert sind.
Dissoziative Fugue
Merkmale
Personen mit einer dissoziativen Fugue verlassen auf einmal und ohne jegliche Vorwarnung ihr Zuhause oder ihren Arbeitsplatz und lassen sich an einem völligen anderen Ort nieder, der sich in der Regel außerhalb ihres vorherigen Lebensbereichs befindet. Dabei können sie mehrere Kilometer zurücklegen oder es kann sie an Orte ihrer Vergangenheit führen, mit denen sie noch gefühlsmäßig verbunden sind. Dieses Wegbleiben von der alltäglichen Umgebung kann entweder von kurzer Dauer (Stunden oder Tage) sein oder sich bis hin zu Monaten erstrecken.
Generell können sich Betroffene während einer Fugue-Phase entweder nur noch an Bruchstücke ihres bisherigen Lebens erinnern oder an gar nichts mehr. Während der Fugue erscheinen sie für Außenstehende äußerst normal und psychisch gesund. Die tägliche Hygiene- und Essensversorgung sowie soziale Kontakte zu Fremden werden aufrechterhalten. Für gewöhnlich nehmen Personen mit einer dissoziativen Fugue keine neue Identität an. Falls es doch dazu kommen sollte, dann geben sie sich einen neuen Namen, suchen sich eine neue Wohnung, neue soziale Aktivitäten, zeigen sich meist besser integriert und geselliger.
Folgen
Neben den bereits genannten Merkmalen der dissoziativen Fugue kommt noch eine dissoziative Amnesie nach dem Zeitabschnitt der Fugue hinzu. Der Erinnerungsverlust kann zum einen für die Zeit der dissoziativen Fugue bestehen, aber auch darüber hinaus bestimmte Traumata der Vergangenheit betreffen. Um von einer dissoziativen Fugue (bzw. von einem psychischen Krankheitsbild) sprechen zu können, müssen die Symptome bei den Betroffenen extremes Leiden auslösen oder soziale, berufliche oder anderweitige einschneidende Beeinträchtigungen mit sich bringen.
Meist geht die dissoziative Fugue mit Gefühlen der Schuld, Scham, Trauer oder Niedergeschlagenheit einher und es können auch aggressive oder suizidale Impulse bestehen. Die Zeit der Fugue hat oft einen schwerwiegenden Einfluss auf die Zeit nach der Fugue. Einige verlieren ihren ursprünglichen Arbeitsplatz oder Familie und Freunde zeigen Unverständnis für ihr plötzliches Verschwinden und wenden sich von ihnen ab.
Weitere Informationen zu den verschiedenen psychischen Erkrankungen finden Sie im Bereich Wissen.
Verlauf
Für gewöhnlich beginnt eine dissoziative Fugue in Verbindung mit ausgesprochenen traumatischen, belastenden oder überwältigenden Situationen im Leben und in der Regel ereignet sich nur eine Episode der Fugue im Laufe eines Lebens. Diese kann von einigen Stunden bis hin zu mehreren Monaten dauern, wobei eine Besserung der Symptome oft sehr rasch eintreten kann. In nur wenigen Fällen bleibt eine Erinnerungslücke für Ereignisse vor der Fugue lebenslang bestehen.
Zahlen
In der Allgemeinbevölkerung liegen die Prävalenzschätzungen für die dissoziative Fugue bei ca. 0,2%, wobei die Rate jedoch ansteigen kann, vor allem bei äußerst belastenden Vorkommnissen, wie bei Naturkatastrophen oder in Zeiten des Krieges.
Subtypen
Beim Störungsbild der dissoziativen Fugue werden keine Subtypen unterschieden.
Dissoziative Fugue -Therapie
In der Regel wird die dissoziative Fugue mit psychoanalytischen Therapien behandelt. Der Patient soll frei assoziieren und in sein Unbewusstes vordringen. Man versucht mit diesen Techniken die vergessenen Erfahrungen wieder bewusst werden zu lassen. Generell sind psychoanalytische Therapeuten darum bemüht Erinnerungen und andere psychische Prozesse wieder aufzudecken, die verdrängt wurden. Damit kommen sie dem Bedürfnis einer von Fugue betroffenen Person entgegen. Allerdings gibt es noch keine kontrollierte Überprüfung des Behandlungserfolgs.
Neben den psychoanalytischen Ansätzen kommt auch die Hypnosetherapie (hypnotische Therapie) bei der dissoziativen Fugue zum Einsatz. Der Patient wird vom Therapeuten hypnotisiert und dazu angehalten die vergessenen Ereignisse ins Gedächtnis zurückzurufen. Es ist bereits bekannt, dass Personen mit einer dissoziativen Störung äußerst suggestibel sind und sich deshalb auch leicht in Hypnose versetzen lassen.
Dissoziative Krampfanfälle
Merkmale
Personen, die an dissoziativen Krampfanfällen leiden, zeigen Epilepsie-ähnliche Anfälle oder auch Pseudoanfälle in Zusammenhang mit einem Zustand, der an einen Stupor (Starrezustand des ganzen Körpers bei wachem Bewusstsein) oder Trancezustand erinnert. Die Krämpfe oder Anfälle lassen zwar eine neurologische oder somatische Störung vermuten, doch lassen körperliche Untersuchungen eine psychische Ursache vermuten. Die dissoziativen Krampfanfälle werden von den Betroffenen weder absichtlich erzeugt noch vorgetäuscht. Um von einem psychischen Krankheitsbild sprechen zu können, müssen die dissoziativen Krampfanfälle erhebliches Leiden bzw. soziale, berufliche oder sonstige Beeinträchtigungen mit sich ziehen.
Des Weiteren können Betroffene auch an weiteren dissoziativen Störungen, an einer Depression oder an einer histrionischen, antisozialen, Borderline oder abhängigen Persönlichkeitsstörung leiden.
Informationen über weitere psychische Erkrankungen erhalten Sie im Wissenbereich auf psycheplus.
Verlauf
psycheplus liegen derzeit keine detaillierten und fundierten Beschreibungen zum charakteristischen Verlauf der dissoziativen Krampfanfälle vor.
Für gewöhnlich beginnen Konversionsstörungen plötzlich in der späten Kindheit und im jungen Erwachsenenalter. Die einzelnen Symptome können sich im Laufe der Zeit verstärken, dauern aber generell nicht lange an, d.h. sie gehen innerhalb von 2 Wochen meistens wieder zurück. Jedoch können die Symptome immer wieder kommen: Bei 20% bis 25% der Betroffenen bereits innerhalb eines Jahres. Falls die Symptome akut beginnen, eine Belastung vor dem Beginn klar ausgemacht werden kann und eine Behandlung der Symptomatik schnell erfolgt, dann stehen die Chancen gut, dass die Konversionsstörung erfolgreich therapiert werden kann.
Zahlen
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen psychplus keine genauen Prävalenzschätzungen zu dissoziativen Krampfanfällen vor.
In der Regel kommen Konversionsstörungen jedoch eher in ländlichen Gegenden bzw. in Entwicklungsregionen und bei Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status vor. Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz für Konversionsstörungen in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen bei ca. 3%. In der Allgemeinbevölkerung liegt der Wert wesentlich niedriger, bei ca. 0,0001%.
Frauen bilden 2 bis 10mal häufiger eine Konversionsstörung aus als Männer. Oft tritt eine Konversionsstörung bei Männern nach einem Arbeitsunfall oder dem Wehrdienst auf.
Subtypen
Beim Störungsbild der dissoziativen Krampfanfälle werden keine Subtypen unterschieden.
Dissoziative Krampfanfälle – Therapie
Können mögliche körperliche Ursachen für die auftretenden Symptome definitiv ausgeschlossen werden, kann von einer Konversionsstörung ausgegangen werden. In der Therapie widmet man sich zunächst einmal den Befürchtungen des Patienten, an einer bedrohlichen körperlichen Erkrankung zu leiden oder „verrückt“ zu werden. Therapeuten beruhigen Betroffene, in dem sie Informationen liefern, dass das Störungsbild dissoziative Krampfanfälle in der Regel ungefährlich ist.
Bei der eigentlichen Behandlung der Symptome einer Konversionsstörung versuchen Therapeut und Patient gemeinsam die situativen Auslöser zu finden und zu beschreiben. Es können sich dabei unverarbeitete Traumatisierungen, Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch in der Kindheit oder weitere Belastungen als Ursache herauskristallisieren. Diese werden therapeutisch so lange bearbeitet, bis verdrängte Scham- oder Schuldgefühle in ein konsistent bejahendes Selbstbild integriert sind.
Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen
Merkmale
Personen, die an einer dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung leiden, weisen Symptome oder Ausfälle von willkürlichen sensorischen Abläufen auf, die zwar eine neurologische oder somatische Störung vermuten lassen, doch legen körperliche Untersuchungen eine psychische Ursache nahe.
Die dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen werden von den Betroffenen weder absichtlich erzeugt noch vorgetäuscht. Es kann zum Verlust der Berührungs- oder Schmerzempfindung kommen und Betroffene können zusätzlich über Parästhesien (Kribbeln unter der Haut) klagen. Selten tritt ein vollständiger Sehverlust auf, die Betroffenen sehen in der Regel nicht mehr so scharf, eher verschwommen oder doppelt. Interessanterweise scheinen sie durch die Seheinschränkungen nicht in ihrer Beweglichkeit und Koordinations- und Gleichgewichtsfähigkeit eingeschränkt zu werden. Auch können Taubheit oder Halluzinationen vorkommen. Um von einem psychischen Krankheitsbild sprechen zu können, müssen die Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen erhebliches Leiden bzw. soziale, berufliche oder sonstige Beeinträchtigungen mit sich ziehen.
Des Weiteren können Betroffene auch an weiteren dissoziativen Störungen, an einer Depression oder an einer histrionischen, antisozialen, Borderline oder abhängigen Persönlichkeitsstörung leiden.
Informieren Sie sich im Bereich Wissen über die verschiedenen psychischen Erkrankungen.
Verlauf
psycheplus liegen im Moment keine detaillierten und fundierten Beschreibungen zum charakteristischen Verlauf der dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung vor.
Für gewöhnlich beginnen Konversionsstörungen plötzlich in der späten Kindheit und im jungen Erwachsenenalter. Die einzelnen Symptome können sich im Laufe der Zeit verstärken, dauern aber generell nicht lange an, d.h. sie gehen innerhalb von zwei Wochen meistens wieder zurück. Jedoch können die Symptome einer Konversionsstörung immer wieder kommen – bei 20-25% der Betroffenen bereits innerhalb eines Jahres. Falls die Symptome akut beginnen, eine Belastung vor dem Beginn klar ausgemacht werden kann und eine Behandlung der Symptomatik schnell erfolgt, dann stehen die Chancen gut, dass die Konversionsstörung erfolgreich therapiert werden kann.
Zahlen
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen psychplus keine genauen Prävalenzschätzungen zur dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung vor.
In der Regel kommen Konversionsstörungen jedoch eher in ländlichen Gegenden bzw. in Entwicklungsregionen und bei Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status vor. Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz für Konversionsstörungen in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen bei ca. 3%, allerdings liegt der Wert in der Allgemeinbevölkerung mit ca. 0,0001% wesentlich niedriger.
Frauen bilden 2 bis 10mal häufiger eine Konversionsstörung aus als Männer; oft tritt eine Konversionsstörung bei Männern nach einem Arbeitsunfall oder dem Wehrdienst auf.
Subtypen
Beim Störungsbild der dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörung werden keine Subtypen unterschieden.
Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen – Therapie
Können mögliche körperliche Ursachen für die auftretenden Symptome definitiv ausgeschlossen werden, kann von einer Konversionsstörung ausgegangen werden. In der Therapie widmet man sich zunächst einmal den Befürchtungen des Patienten, an einer bedrohlichen körperlichen Erkrankung zu leiden oder „verrückt“ zu werden und so beruhigen Therapeuten Betroffene, indem sie Informationen liefern, dass das Störungsbild in der Regel ungefährlich ist.
Bei der eigentlichen Behandlung der Symptome der Konversionsstörung versuchen Therapeut und Patient gemeinsam die situativen Auslöser zu finden und zu beschreiben. Es können sich dabei unverarbeitete Traumatisierungen, Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch in der Kindheit oder weitere Belastungen als Ursache herauskristallisieren. Diese werden therapeutisch so lange bearbeitet, bis verdrängte Scham- oder Schuldgefühle in ein konsistent bejahendes Selbstbild integriert sind.
Dissoziative Symptome
Dissoziative Symptome als Kennzeichen der dissoziativen Störungen ist der teilweise oder vollständige Verlust des Erinnerungsvermögens (dissoziative Amnesie), des Identitätsbewußtseins (dissoziative Fugue, multiple Persönlichkeit, Trance und Besessenheitszustände), der Sinnesempfindungen (dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörung) oder der Bewegung (dissoziative Bewegungstörung, dissoziativer Stupor, dissoziative Krampfanfälle).
Dissoziativer Stupor
Merkmale
Bei Personen, die unter einem dissoziativen Stupor leiden, befindet sich der ganze Körper in einem starren Zustand, obwohl die Personen selbst wach sind. Bewegungen werden nur langsam oder gar nicht ausgeführt. Betroffene sitzen oder liegen lange Zeit bewegungslos, sprechen kaum oder gar nicht und feste oder flüssige Nahrung wird entweder gar nicht oder nur durch die Hilfe einer Pflegeperson aufgenommen.
Dissoziativer Stupor zeigt sich für Außenstehende dadurch, dass weder Bewegungen, noch Gefühle oder andere Reaktionen z.B. auf Licht, Geräusche oder Berührungen erkennbar sind, auch wenn der Betroffene bei Bewusstsein ist, Reize aus seiner Umwelt wahrnimmt und verarbeitet. Lediglich der Muskeltonus, die Haltung, die Atmung und ein gelegentliches Öffnen der Augen oder koordinierte Augenbewegungen lassen den Rückschluss zu, dass die Person mit einem dissoziativen Stupor noch bei Bewusstsein ist und nicht schläft. Untersuchungen oder Befragungen liefern keinen Hinweis für eine körperliche Ursache, sondern für eine psychische, ausgelöst durch eine vorausgegangene belastende Situation.
Dissoziativer Stupor – Verlauf
psycheplus liegen im Moment keine detaillierten und fundierten Beschreibungen zum charakteristischen Verlauf des dissoziativen Stupors vor.
Für gewöhnlich beginnen Konversionsstörungen plötzlich in der späten Kindheit und im jungen Erwachsenenalter. Die einzelnen Symptome können sich im Laufe der Zeit verstärken, dauern aber generell nicht lange an, d.h. sie gehen innerhalb von zwei Wochen meistens wieder zurück. Jedoch können die Symptome immer wieder kommen, bei 20-25% der Betroffenen bereits innerhalb eines Jahres. Falls die Symptome akut beginnen, eine Belastung vor dem Beginn klar ausgemacht werden kann und eine Behandlung der Symptomatik schnell erfolgt, stehen die Chancen gut, dass die Konversionsstörung erfolgreich therapiert werden kann.
Zahlen
Zum aktuellen Zeitpunkt liegen psychplus keine Prävalenzschätzungen des dissoziativen Stupor vor.
In der Regel kommen Konversionsstörungen jedoch eher in ländlichen Gegenden bzw. in Entwicklungsregionen und bei Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status vor. Schätzungen zufolge liegt die Prävalenz für Konversionsstörungen in psychiatrischen Versorgungseinrichtungen bei ca. 3%. In der Allgemeinbevölkerung liegt der Wert wesentlich niedriger, bei ca. 0,0001%.
Frauen bilden 2 bis 10mal häufiger eine Konversionsstörung aus als Männer. Oft tritt eine Konversionsstörung bei Männern nach einem Arbeitsunfall oder dem Wehrdienst auf.
Subtypen
Bei dem Störungsbild des dissoziativen Stupors werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Können mögliche körperliche Ursachen für die auftretenden Symptome definitiv ausgeschlossen werden, kann von einer Konversionsstörung ausgegangen werden. In der Therapie widmet man sich zunächst einmal den Befürchtungen des Patienten, an einer bedrohlichen körperlichen Erkrankung zu leiden oder „verrückt“ zu werden. Therapeuten beruhigen Betroffene, in dem sie Informationen liefern, dass das Störungsbild in der Regel ungefährlich ist.
Bei der eigentlichen Behandlung der Symptome der Konversionsstörung versuchen Therapeut und Patient gemeinsam die situativen Auslöser zu finden und zu beschreiben. Es können sich dabei unverarbeitete Traumatisierungen, Gewalterfahrungen oder sexueller Missbrauch in der Kindheit oder weitere Belastungen als Ursache herauskristallisieren. Diese werden therapeutisch so lange bearbeitet, bis verdrängte Scham- oder Schuldgefühle in ein konsistent bejahendes Selbstbild integriert sind.
Dyssomnie
Dyssomnien sind bestimmte Formen von Schlafstörungen. Darunter zählen Ein- und Durchschlafschwierigkeiten sowie eine extreme Müdigkeit.
Dysthymie
Eine Dysthymie ähnelt den Symptomen einer Depression, jedoch erfüllt diese nicht alle Kriterien, welche die Diagnose einer Depression verlangen. Daher wird die Dysthymie als eine chronische Form von depressiven Verstimmungen bezeichnet.