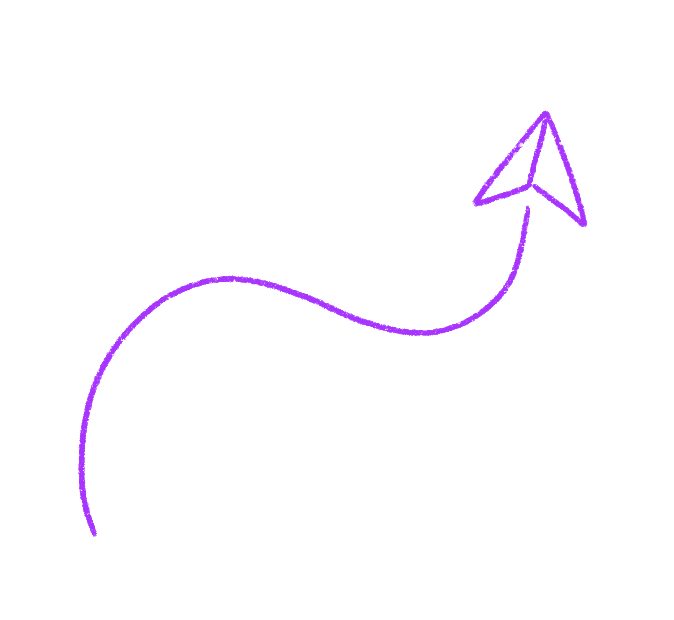Panikstörung
Merkmale
Das wesentliche Kriterium der Panikstörung sind wiederkehrende, schwere Angstanfälle (Panik), die vom Betroffenen nicht vorhergesehen werden können, da sie unabhängig von bestimmten Situationen auftreten. Die Beschwerden treten abrupt auf („wie aus heiterem Himmel“) und steigern sich innerhalb von ca. 10 Minuten zu einem Maximum. Während einer Panikattacke können folgende Symptome auftreten:
- Herzklopfen oder Herzrasen
- Schwitzen
- Zittern oder Beben
- Atemnot, Erstickungsgefühle
- Brustschmerzen oder Beklemmungsgefühle
- Übelkeit oder Magen-Darm-Beschwerden
- Schwindel oder Benommenheit
- Hitzewallungen oder Kälteschauer
- Taubheits- oder Kribbelgefühle
- Gefühl, dass man selbst „nicht richtig da“ ist (Depersonalisation)
- Gefühl, dass die Umgebung „unwirklich“ ist (Derealisation)
- Angst die Kontrolle zu verlieren oder wahnsinnig zu werden
- Angst zu sterben
Die Symptome einer Panikstörung variieren sehr stark von Person zu Person. Erst wenn mindestens vier der genannten Symptome auftreten, ist eine Panikattacke wahrscheinlich. Eine Panikattacke dauert meist zwischen 10 und 30 Minuten, kann aber auch in seltenen Fällen nur zwei Minuten oder bis zu zwei Stunden andauern. Da sich die Beschwerden innerhalb weniger Minuten zu einem Höhepunkt steigern, führt dies häufig dazu, dass die Betroffenen in dieser Situation den Notarzt rufen oder fluchtartig den Ort verlassen.
Nach einer Panikattacke entwickelt der Betroffene meist eine große Furcht vor einem weiteren Angstanfall („Angst vor der Angst“). Diese Erwartungsangst kann gravierende Folgen für den Betroffenen haben, z.B. zieht er sich immer mehr zurück, traut sich nicht mehr sich an bestimmten Orten aufzuhalten, an denen ein Angstanfall schon einmal aufgetreten ist oder vermeidet körperliche Anstrengung. Das Vermeidungsverhalten kann sich so weit verstärken, dass zusätzlich zu der Panikstörung die Kriterien einer Agoraphobie erfüllt sind. Betroffene befürchten häufig an einer lebensbedrohlichen Krankheit zu leiden, die die Ursache für die Panikattacken ist. Eine medizinische Untersuchung kann diesbezüglich Sicherheit bringen. Auszuschließen sind Herz- und Gefäßerkrankungen, Asthma, Schilddrüsenerkrankungen, Anfallsleiden (Epilepsie), Diabetes mellitus, aber auch Nebenwirkungen von Medikamenten und Drogenmissbrauch. Sobald eine körperliche Ursache von Seiten des Arztes ausgeschlossen wurde, ist es nicht mehr nötig, die Untersuchungen immer wieder zu wiederholen, auch wenn die Angst ständig gegenwärtig ist.
Bei manchen von einer Panikstörung Betroffenen (häufig Männer im mittleren Lebensalter) steht die kardiale (Herz-) Symptomatik ganz im Zentrum des Erlebens. Früher wurde dieses Phänomen als „Herzphobie“ oder „Herzangstsyndrom“ bezeichnet. Der Betroffene erlebt eine anfallsartig auftretende kardiale Symptomatik, ohne dass hierfür eine körperliche Ursache gefunden werden kann, sowie intensive Angst an Herzversagen zu sterben. Oft lässt sich als Auslöser für die Angst eine Herzerkrankung im näheren Umfeld des Betroffenen finden.
Weitere Informationen zu den verschiedenen psychischen Erkrankungen finden Sie im Wissensbereich bei psycheplus.
Verlauf
Der Erkrankungsbeginn liegt bei der Panikstörung meist zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr. Panikattacken treten meist wiederholt auf, häufig mehrmals pro Woche oder in schweren Fällen sogar täglich. Eine Panikstörung bleibt meist über mehrere Jahre bestehen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Bei manchen Betroffenen hat die Störung einen episodischen Verlauf, mit jahrelangen angstfreien Zeiträumen. Andere erleben hingegen eine durchgehend schwere Symptomatik.
Tritt eine Panikstörung zusammen mit einer Agoraphobie auf, sind die Beeinträchtigungen in der persönlichen Lebensführung besonders gravierend. Der Betroffene kann schlimmstenfalls nicht mehr das Haus verlassen und unter chronischer Angst leiden. Der Missbrauch von Alkohol und Beruhigungsmitteln kann bei einem langwierigen Verlauf ein Versuch des Betroffenen sein, zumindest zeitweise die Angst zu betäuben. Nicht selten berichten Betroffene zusätzlich zu der Panikstörung von einer depressiven Symptomatik.
Studien ergaben, dass 6-10 Jahre nach der Behandlung etwa 30% der Patienten mit einer Panikstörung keine Symptome mehr hatten, 40-50% eine Besserung der Symptomatik zeigten und sich bei 20-30% die Beschwerden nicht verändert haben oder etwas schlechter geworden sind.
Zahlen
Die Wahrscheinlichkeit im Laufe seines Lebens an einer Panikstörung zu erkranken liegt bei 3- 4%. Die Häufigkeit ist im Vergleich zu anderen Angststörungen eher niedrig, jedoch bedarf eine Panikstörung am häufigsten einer Behandlung. Isolierte Panikattacken sind wesentlich häufiger, ca. 11% der Frauen und 7% der Männer erleben im Laufe ihres Lebens eine Panikattacke. Studien gehen davon aus, dass ca. 10-30% der Patienten in allgemeinmedizinischen Einrichtungen an einer Panikstörung leiden. Frauen erkranken in etwa doppelt so häufig an einer Panikstörung wie Männer.
Subtypen
Bei diesem Störungsbild werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Bei der Panikstörung haben sich besonders Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie als hilfreich erwiesen. Mit den kognitiven Verfahren versucht der Therapeut eingefahrene Gedankenmuster des Patienten zu korrigieren. Dem Patienten wird verständlich gemacht, welche Gedanken dazu beitragen, dass die Angst entsteht, aufrechterhalten bleibt und sich weiter verstärkt. Die Therapie kann in einer Einzel- oder auch Gruppentherapie stattfinden.
In Kombination mit verhaltenstherapeutischen Methoden werden häufig Entspannungsverfahren bei einer Panikstörung verwendet, da der Zustand der Entspannung das Gefühl von Angst ausschließt. Die bekanntesten Verfahren sind die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, das Autogene Training, sowie Biofeedback.
In einer tiefenpsychologisch orientierten Therapie versucht der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten herauszufinden, welcher unbewusste Konflikt der Angstsymptomatik zugrunde liegt (sogenannte aufdeckende Verfahren). Häufig lässt sich bei Patienten mit einer Angststörung, wie der Panikstörung, ein ambivalent erlebter Trennungskonflikt finden. Das bedeutet es bestehen beispielsweise gleichzeitig Abhängigkeitsgefühle und Aggressionen gegenüber der Mutter oder dem Partner. Es kann jedoch auch bei den aufdeckenden Verfahren zunächst wichtig sein, die Angstbewältigungsmöglichkeiten des Patienten zu stärken. Eine tiefenpsychologische Therapie dauert in der Regel länger als eine Verhaltenstherapie. Sie wird bis zu mehrere Jahre kontinuierlich angewandt.
Paranoide Persönlichkeitsstörung
Merkmale
Das Hauptmerkmal der paranoiden Persönlichkeitsstörung ist ein Muster tiefgreifenden Misstrauens und Argwohns anderen Menschen gegenüber. Paranoide Personen neigen stark dazu, das Verhalten anderer als feindlich oder böswillig zu interpretieren und selbst freundlich gemeinte Handlungen oder Äußerungen eine abwertende Bedeutung zuzuschreiben. So kann z.B. eine humorvolle Bemerkung als Angriff gewertet werden. Obwohl es keine objektiven Beweise gibt, erwarten Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung, dass andere ihnen schaden, sie ausbeuten oder hintergehen wollen. Deshalb vertrauen sie sich auch nur zögernd oder ungern anderen Menschen an, da sie befürchten die Informationen könnten gegen sie verwendet werden. Auf Rückschläge oder Zurückweisung reagieren Personen mit einer paranoiden Persönlichkeit übertrieben empfindlich und zeigen in Folge dessen oft streitsüchtiges oder zorniges Verhalten, beharren selbst wenn es nicht angemessen ist auf ihren Rechten oder starten schnell Gegenangriffe.
Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung sind sehr lange nachtragend oder neigen zu ständigem Groll, da sie Verletzungen, Kränkungen oder Missachtungen anderer nicht verzeihen können. Selbst an der Loyalität der Freunde und Familienangehörigen wird gezweifelt. Der Sexual- oder Ehepartner wird aufgrund pathologischer Eifersucht wiederholt und ungerechtfertigt der Untreue beschuldigt und ständig kontrolliert. Paranoide Personen sammeln bedeutungslose „Beweise“, um ihren Verdacht zu stützen.
Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstruktur zeigen oft eine Tendenz zu einem überhöhten Selbstwertgefühl und starker Selbstbezogenheit. Außerdem beschäftigen sie sich ständig mit Verschwörungstheorien, als Erklärung für jegliche Ereignisse in ihrer nahen Umgebung, aber auch weltweit. Menschen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung haben oft Probleme mit engen Beziehungen. Aufgrund des ausgeprägten Misstrauens sind sie sehr reserviert und zurückhaltend oder auch sehr streitlustig, feindselig und sarkastisch. Durch ihre Art können andere zu abwertenden Reaktionen provoziert werden, was dann wiederrum die Erwartung der paranoiden Person bestärkt.
Des Weiteren besteht bei Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung der ausgeprägte Wunsch nach Autonomie und absoluter Kontrolle der Mitmenschen. Betroffene sind zwar anderen gegenüber extrem kritisch, können aber selbst sehr schlecht mit Kritik umgehen und versuchen meist andere Personen für ihre eigenen Unzulänglichkeiten verantwortlich zu machen. Nicht selten haben paranoide Personen unrealistische, grandiose Phantasien, Vorurteile und negative Stereotypien gegenüber anderen Menschen, insbesondere gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen. Daraus können sich z.B. Sekten oder Gruppen mit Menschen bilden, die die gleichen Vorstellungen teilen. Menschen, die unter einer paranoiden Persönlichkeitsstörung leiden, können auf Stress mit kurzen psychotischen Episoden reagieren, die von einigen Minuten bis hin zu Stunden andauern können.
Aus einer paranoiden Persönlichkeitsstörung kann sich unter Umständen eine wahnhafte Störung oder eine Schizophrenie entwickeln. Des Weiteren können Betroffene eine Depression, eine Agoraphobie oder eine Zwangsstörung entwickeln. Nicht selten tritt die Persönlichkeitsstörung in Kombination mit Substanzmissbrauch bzw. -abhängigkeit auf. Die schizotype, narzisstische, ängstlich-vermeidende und die Borderline Persönlichkeitsstörung treten am häufigsten gemeinsam mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung auf.
Informieren Sie sich über weitere psychische Erkrankungen im Bereich Wissen auf psycheplus.
Verlauf
Die paranoide Persönlichkeitsstörung kann sich in der Kindheit oder Jugend in verschiedenen Auffälligkeiten zeigen. So fallen Betroffene schon früh als Einzelgänger auf, haben wenige Beziehungen zu Gleichaltrigen, sind sozial gehemmt bzw. leiden unter sozialen Ängsten, sind schlecht in der Schule, zeigen eine seltsame Denk- und Sprechweise, reagieren häufig überempfindlich und feindselig und werden häufig von unrealistischen Phantasien eingenommen. Die typischen Merkmale der paranoiden Persönlichkeitsstörung zeigen sich meist in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter und sind stabil im Zeitverlauf.
Zahlen
In der Allgemeinbevölkerung wird bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung von einer Prävalenz von 0,5% bis 2,5% ausgegangen. In klinischen Populationen sind die Zahlen höher. Sie liegen bei ca. 10% bis 30% der Patienten in stationärer Behandlung und ca. 2% bis 10% bei Patienten in ambulanter Behandlung. Männer sind von einer paranoiden Persönlichkeitsstörung häufiger betroffen als Frauen.
Subtypen
Bei dem Störungsbild der paranoiden Persönlichkeitsstörung werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Eine Therapie der paranoiden Persönlichkeitsstörung gestaltet sich schwierig, da die meisten Betroffenen gar nicht in Therapie gehen oder meist nur aufgrund anderer Beeinträchtigungen durch gleichzeitig auftretende Störungen, wie einer Depression oder Substanzabhängigkeit, eine Therapie beginnen. Während der Therapie können spezifische Probleme auftreten- so kommen die meisten Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung meist nicht mit der Rolle als Patient zurecht und werten den Therapeuten ab bzw. verhalten sich sehr misstrauisch ihm gegenüber und widersetzen sich der Therapie. Der Therapieerfolg ist somit für die paranoide Persönlichkeitsstörung nur sehr begrenzt.
In einer Verhaltenstherapie soll bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung zunächst die erhöhte Reaktionsbereitschaft und Wachsamkeit der Patienten reduziert werden. Dazu wird ihr Selbstwirksamkeitsgefühl, also das Gefühl Probleme selbst bewältigen zu können und die Kontrolle über ihre Ängste zu haben, gestärkt. Dieses neu gewonnene Sicherheitsgefühl ermöglicht es den Patienten ihre paranoiden Gedankenmuster zu hinterfragen und alternative Denkweisen zu testen. Paranoide Personen lernen die Motive und Verhaltensweisen anderer realistischer einzuschätzen und günstigere Problemlösestrategien anzuwenden.
In einer analytischen Therapie versucht der Therapeut, gemeinsam mit dem paranoiden Patienten, zu seinen unbewussten Gefühlen und Bedürfnissen vorzudringen, die von dem vordergründig feindseligen Verhalten überdeckt werden. Analytisch arbeitende Therapeuten gehen davon aus, dass Personen mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung eigentlich einen tiefen Wunsch nach einer engen und befriedigenden Beziehung haben. Es ist jedoch nicht hinreichend belegt, ob die analytische Therapie wirksam ist.
Eine medikamentöse Therapie gilt bei der paranoiden Persönlichkeitsstörung im Allgemeinen als unwirksam.
Parkinson-Syndrom
Parkinson (oder Morbus Parkinson) ist eine neurologische Erkrankung, bei der aufgrund von einem stetigen Absterben der Nervenzellen im Gehirn, die Dopamin enthalten, die Bewegungsabläufe des Körpers gestört sind. Die Krankheit tritt überwiegend zwischen dem 55. und 65. Lebensjahr auf und zählt zu den häufigsten neurologischen Erkrankungen. Umgangssprachlich auch Schüttelkrankheit genannt.
Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung
Merkmale
Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung sind geprägt von negativistischen Einstellungen, die alle Bereiche des Lebens betreffen und beeinflussen. Außerdem zeigen sie ein passives Widerstandsverhalten gegenüber jeglichen Bitten und Forderungen nach gerechtfertigter Leistung im Arbeitsbereich. Das gleiche gilt für soziale Situationen. Von der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung Betroffene verzögern oder vergessen absichtlich, strengen sich sich an und zeigen Eigensinnigkeit bei solchen Aufgaben, bei denen andere von der Arbeit der Person abhängig sind und durch deren kontraproduktives Verhalten behindert werden.
Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung – Folgen
Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung sind zudem schnell nachtragend, fühlen sich betrogen, missachtet, unverstanden und beklagen sich ständig bei anderen. Sie sind des Öfteren leicht reizbar, ungeduldig, streitsüchtig, skeptisch und mürrisch. Für ihre Fehler oder Missgeschicke finden sie meist andere Schuldige. Schon bei der kleinsten Kritik z.B. an ihrer Arbeit, reagieren passiv-aggressive Menschen mit verbalen Feindseligkeiten gegenüber der Autoritätsperson. Des Weiteren gönnen sie es ihren Kollegen nicht, wenn diese erfolgreicher sind oder besser bewertet werden als sie. Auch zeigen Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung eine negative Einstellung bezüglich der Zukunft. Im Allgemeinen bauen sie nur sehr langsam enge und stabile Beziehungen zu nur wenigen, „handverlesenen“ Interaktionspartnern auf. Zu anderen bleiben passiv-aggressive Personen distanziert.
Verlauf
psycheplus liegen keine fundierten Beschreibungen zum Verlauf der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung vor.
Zahlen
psycheplus liegen derzeit keine aktuellen Prävalenzschätzungen der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung vor.
Subtypen
Bei dem Störungsbild der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
In der Regel nehmen Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung eine Therapie in Anspruch, wenn sie merken, dass die negativen Erfahrungen, die sie mit anderen Menschen machen im Zusammenhang mit ihrem negativistischen Verhalten stehen oder sie sich von anderen gemobbt fühlen. Sie sind jedoch der festen Überzeugung, dass ihr abweisendes Verhalten notwendig ist, um Grenzen zu ziehen und sich dadurch selbst schützen zu können. Auch sind passiv-aggressive Menschen der Meinung, dass sie ihre Interaktionspartner immer im Blick haben und überwachen müssen, damit diese ihre Grenzen nicht überschreiten. In der Therapie der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung ist es deshalb extrem wichtig, dass Therapeut und Patient eine gute und vertrauensvolle Arbeitsbeziehung aufbauen.
In der kognitiven Verhaltenstherapie bemühen sich Therapeuten passiv-aggressiven Patienten Transparenz zu liefern, indem sie alles kurz und prägnant kommentieren und erläutern, was sie tun, warum sie es tun und was sie damit weiter vorhaben. Außerdem erhalten Personen mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung die Kontrolle darüber, über was in der Therapie gesprochen wird. In ist wichtig, dass die Themen sie persönlich betreffen. Von zentraler Bedeutung in der Therapie der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung ist es, die Grenzen der Betroffenen nicht zu überschreiten.
Gewinnen sie den Eindruck, dass ihre Grenzen respektiert und der Therapeut ihnen tatsächlich weiterhelfen will, kann er ihre Biographie rekonstruieren und Erfahrungen und Verhaltensschemata, die sich mit der Zeit ausgebildet haben aufgedecken. Letztendlich können die Patienten mit einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung mit Hilfe des Therapeuten ihre typischen Sabotagestrategien bearbeiten und neue Verhaltensweisen trainieren.
Pathologisches Spielen (Spielsucht)
Merkmale
Das Hauptmerkmal des pathologischen Spielens ist ein andauerndes, wiederholtes und fehlangepasstes Spielverhalten. Die gesamte Lebensführung des Betroffenen wird dadurch beeinträchtigt und es kommt zu erheblichen Problemen im sozialen, familiären, beruflichen und materiellen Bereich.
Betroffene erleben einen starken, unkontrollierbaren Drang zu spielen und beschäftigen sich gedanklich mit den vergangenen Spielerlebnissen, dem Planen der nächsten Spielepisode oder mit Möglichkeiten weiteres Geld dafür zu beschaffen. Diese gedankliche Ausrichtung auf das Spielen verstärkt sich meist in belastenden Lebenssituationen. Häufig sind es nicht die Gewinne, sondern das euphorische Gefühl, das die Betroffenen suchen. Dabei müssen immer größere Geldmengen eingesetzt werden, um diesen aufregenden, euphorischen Zustand herbeizuführen. Betroffene versuchen zwar meist immer wieder mit dem Spielen aufzuhören, aber letztendlich setzen sie es doch fort. Oftmals kommt es im Zuge des pathologischen Spielens zu Unruhe und erhöhter Reizbarkeit bei den Versuchen das Spielen zu unterlassen.
Hinter der Spielsucht stehen häufig Gefühle der Hilflosigkeit, Minderwertigkeit, Schuld, Angst oder Probleme, vor denen der Betroffene zu fliehen oder sich zumindest zeitweise abzulenken versucht. Ein weiteres Merkmal des pathologischen Spielens ist das langandauernde „Hinterherjagen“ hinter Verlusten, die der Betroffene wieder ausgleichen will. Dazu werden oft noch größere Wetteinsätze oder noch höhere Risiken in Kauf genommen. Die Schulden, der zeitliche Aufwand und die Verstrickung in Lügen ziehen zum einen berufliche Probleme nach sich, wie etwa das Risiko des Arbeitsplatzverlustes, zum anderen soziale und familiäre Probleme, wie eine Scheidung oder die Distanzierung der Freunde und Angehörigen. Es kann dazu kommen, dass Betroffene gesetzeswidrig handeln, wie z.B. Betrug, Diebstahl, Fälschung oder andere antisoziale Handlungsweisen begehen oder ihre Familie und Freunde „ausnutzen“, um an Geld zu kommen oder um Schulden zu bezahlen.
Betroffene sind oft anfällig für die Entwicklung körperlicher Krankheiten, wie etwa Migräne oder Magengeschwüre, die mit Stress einhergehen. Nicht selten berichten Betroffene, die sich in Therapie begeben, von Selbstmordgedanken oder -versuchen im Laufe ihrer Krankheitsgeschichte. Symptome wie Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität in der Kindheit scheinen ein Risikofaktor für die Entwicklung pathologischen Spielverhaltens zu sein.
Pathologisches Spielen tritt häufig in Kombination mit affektiven Störungen (z.B. Depression), Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörungen, Störungen durch psychotrope Substanzen, anderen Störungen der Impulskontrolle sowie der antisozialen, der narzisstischen und der Borderline Persönlichkeitsstörung auf.
Weitere Informationen zu verschiedenen psychischen Erkrankungen finden Sie in der Wissenssektion bei psycheplus.
Verlauf
Pathologisches Spielen entwickelt sich bei jungen Männern meist im frühen Erwachsenenalter, bei Frauen erst in späteren Lebensjahren. Bei der Mehrzahl der Fälle ist der Beginn schleichend, es kann jedoch schon eine Wette oder ein Spiel genügen, um die Störung auszulösen. Ebenso kann es sein, dass erst ein belastendes Ereignis, ein ansonsten normales Spielverhalten pathologisch werden lässt. Das Spielverhalten kann in einzelnen Episoden oder auch sehr regelmäßig und kontinuierlich auftreten.
Der Verlauf des pathologischen Spielens ist meist chronisch und oft ist der Leidensweg ähnlich lang wie bei Suchtkranken. Im Laufe der Krankheitsgeschichte kommt es zu immer gravierenderen Auswirkungen. So verlieren Familie und Beruf immer mehr an Bedeutung oder es kommt zu einer sozialen Isolierung des Betroffenen. Irgendwann ist das gesamte Leben des Betroffenen vom Spielen eingenommen und der Betroffene sieht sich oftmals nicht mehr in der Lage ohne Hilfe aus seiner Situation zu entkommen.
Zahlen
In Deutschland ist das pathologische Spielen nicht so häufig wie in den Vereinigten Staaten. Hierzulande geht man Schätzungen zufolge von ca. 0,1% bis 0,2% Betroffener aus, während die Prävalenz in den Vereinigten Staaten bei ca. 1% bis 3% liegt.
Subtypen
Bei diesem Störungsbild werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Die Therapie des pathologischen Spielens sollte neben einer psychotherapeutischen Behandlung Maßnahmen zur Schuldenregulierung beinhalten.
Eine Therapie kann als Einzeltherapie oder als Gruppentherapie durchgeführt werden. Eine Gruppentherapie hat einige Vorteile, u.a. dass Betroffene ihre Scham und Schuldgefühle besser abbauen können und sich direkt über die Folgeprobleme und deren Bewältigung austauschen und voneinander lernen können.
Die Ansatzpunkte der Therapie werden individuell festgelegt und können folgendes umfassen:
Den Aufbau einer Veränderungsmotivation,
das Identifizieren und Ändern verzerrter, unrealistischer Gedankenmuster,
eine Rückfallprävention, im Rahmen derer Bewältigungsstrategien in Risikosituationen geübt werden,
den Aufbau und die Stabilisierung des Selbstwerts,
der Umgang mit negativen Gefühlen und Unruhe,
Verbesserung des Sozialverhaltens und der Beziehungen und
die Behandlung eventuell bestehender komorbider Störungen, wie z.B. Depressionen oder Abhängigkeitserkrankungen.
Die Therapie des pathologischen Spielens kann sowohl stationär als auch ambulant erfolgen. Bei einer stationären Behandlung ist die Therapie zwar intensiver und eventuell können schneller Erfolge erzielt werden. Bei einer ambulanten Therapie kann das Gelernte jedoch sofort umgesetzt und im Alltag geübt werden. Außerdem entfällt das Problem der Wiedereingliederung, das bei einer stationären Therapie zu berücksichtigen ist.
Pavor Nocturnus (Nachtangst)
Merkmale
Das wesentliche Merkmal des Pavor Nocturnus sind nächtliche Episoden intensiver Angst mit heftigen Panikschreien, körperlichen Bewegungen und autonomer Erregung. Die Episoden treten meist im ersten Drittel der Nacht auf und dauern zwischen einer und zehn Minuten. Die betroffene Person schreckt mit einem Panikschrei aus dem Schlaf auf und zeigt körperliche Angstsymptome, wie z.B. schnelle Atmung, Hautrötung, Schwitzen und erhöhte Muskelspannung. Während einer Episode ist die Person kaum zu wecken oder zu beruhigen. Ein Eingreifen anderer kann im Gegenteil zu noch heftigerer Angst führen, da die Person für einige Minuten desorientiert und durcheinander sein kann. Es kann sein, dass sich die Person aktiv dagegen wehrt, festgehalten zu werden oder sogar differenzierte Bewegungsabläufe (wie z.B. Boxen oder Flüchten) zeigt. Diese Verhaltensweisen können als Versuch der Selbstverteidigung oder Flucht vor einer Gefahr gedeutet werden und tragen zu einem erhöhten Verletzungsrisiko bei. Wenn die Person nach einer Episode von Pavor Nocturnus aufwacht, kann sie sich nicht an einen konkreten Trauminhalt erinnern (wie bei Albträumen), sondern höchstens an einzelne fragmentarische Bilder. Meistens wacht die Person nicht ganz auf, schläft wieder ein und kann sich am nächsten Morgen nicht an das Ereignis erinnern.
Es kann vorkommen, dass Episoden gleichzeitig Merkmale des Pavor Nocturnus und des Schlafwandelns aufweisen. Risikofaktoren für das Auftreten von Pavor Nocturnus sind der Gebrauch von Alkohol und Beruhigungsmitteln, Schlafentzug, eine Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, Müdigkeit sowie körperliche und seelische Belastungen.
Um die Diagnose des Pavor Nocturnus stellen zu können, muss der Betroffene deutlich unter den Episoden leiden oder beeinträchtigt sein. Die wiederholten Episoden können auch negative Folgen im sozialen Bereich haben, da der Betroffene aus Scham Situationen vermeidet, in denen andere die Episoden mitbekommen könnten (z.B. beim Übernachten bei Freunden, dem Partner oder bei Urlauben).
Bei Erwachsenen treten häufig andere psychische Störungen im Zusammenhang mit Pavor Nocturnus auf. Vor allem bei Personen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder generalisierten Angststörung kommen Episoden von Pavor Nocturnus häufig vor. Auch Persönlichkeitsstörungen können im Zusammenhang mit Pavor Nocturnus auftreten. Bei Kindern findet sich keine erhöhte Wahrscheinlichkeit an anderen psychischen Störungen zu erkranken.
Informieren Sie sich über weitere psychische Erkrankungen auf psycheplus im Bereich Wissen.
Verlauf
Bei Kindern tritt ein Pavor Nocturnus meist zwischen dem 4. und 12. Lebensjahr auf – mit einer Häufung um die Einschulungszeit – und verschwindet meist spontan in der Adoleszenz. Bei Erwachsenen beginnt der Pavor Nocturnus gewöhnlich zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr und verläuft meist chronisch, mit schwankender Intensität und Häufigkeit der Episoden. Die Häufigkeit kann bei der betroffenen Person selbst über die Zeit hinweg variieren und ist auch bei verschiedenen Personen unterschiedlich stark. Meist liegt zwischen den Episoden ein Zeitraum von einigen Tagen oder Wochen, sie können aber auch an aufeinanderfolgenden Tagen auftreten.
Zahlen
Es gibt nur unzureichende Angaben über die Prävalenz des Pavor Nocturnus. Schätzungsweise treten einzelne Episoden (keine wiederholten Episoden sowie klinisch bedeutsames Leiden und Beeinträchtigung) bei 1% bis 6% der Kinder und bei nur 1% der Erwachsenen auf. Bei Kindern tritt der Pavor Nocturnus häufiger bei Jungen als bei Mädchen auf. Bei Erwachsenen ist die Verteilung gleich.
Subtypen
Bei diesem Störungsbild werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Tritt der Pavor Nocturnus bei Kindern auf, ist in der Regel keine spezielle Therapie notwendig, da die Problematik meist von selbst zurückgeht und an sich keine ernste Störung ist. Verletzungsgefahr sollte jedoch vermieden werden. Wichtig ist eine Differenzialdiagnose, um andere Störungen auszuschließen. Durch eine genaue Aufklärung sollten insbesondere besorgte Eltern beruhigt werden.
Ist der Pavor Nocturnus chronisch, kann eine Verhaltenstherapie oder auch medikamentöse Behandlung sinnvoll sein. Meist reicht es jedoch schon einige Regeln der Schlafhygiene (siehe Selbsthilfetipps) zu befolgen und Stress zu reduzieren. Dazu eignen sich besonders die Progressive Muskelentspannung nach Jacobsen und Autogenes Training.
Pick-Krankheit
Die Pick-Krankheit (Morbus Pick) ist eine Form der Demenz, die sich zunächst nicht in Form von Vergeßlichkeit äußert, sondern in Form einer kontinuierlichen Veränderung der eigenen Persönlichkeit und des erlernten Sozialverhaltens.
Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
Merkmale
Traumatisierende Ereignisse, die häufig eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen, können folgende sein:
- Kriegserfahrungen, Folterung, kämpferische Auseinandersetzungen
- Vergewaltigung, sexuelle Belästigung
körperlicher Angriff, Raubüberfall, Straßenüberfall - Entführung, Geiselnahme, Internierung
Terroranschlag - Missbrauchserfahrungen in der Kindheit
- Persönliche Extrembelastungen (z. B. lebensbedrohliche Erkrankung, Verbrennungen)
- Naturkatastrophen oder durch Menschen verursachte Katastrophen
- Schwere (Auto-)Unfälle
- Beobachtung einer schweren Verletzung oder des Todes bei einer anderen Person
- Ereignisse, die anderen Personen zugestoßen sind und von denen man erfahren hat (z.B. Unfälle, schwere Verletzungen, unerwarteter Tod oder Nachricht über eine lebensbedrohliche Erkrankung eines Familienmitglieds)
Ein charakteristisches Symptom der posttraumatischen Belastungsstörung, das aufgrund der Konfrontation mit dem traumatischen Erlebnis auftritt, ist das wiederholte Erleben des Traumas. Dieses Wiedererleben kann auf verschiedene Weise stattfinden. Häufig haben Betroffene aufdringliche Erinnerungen an das Ereignis oder belastende Träume, in denen das Ereignis nachgespielt wird. Seltener treten sogenannte „Flashbacks“ auf, also kurzdauernde dissoziative Zustände, in denen der Betroffene einzelne Ausschnitte des Traumas (z.B. in Form von Illusionen oder Halluzinationen) wiedererlebt. Eine intensive psychische Belastung oder körperliche Reaktionen treten häufig bei einer Konfrontation mit einem Reiz, der an das Trauma erinnert, auf.
Betroffene leiden darüber hinaus unter einem andauernden Gefühl von Betäubtsein und Empfindungslosigkeit, vermindertem Interesse an Aktivitäten, die früher Freude bereitet haben und Entfremdung von anderen, sowie dem Gefühl einer eingeschränkten Zukunft (Betroffene erwarten nicht, in Zukunft ein normales Leben zu führen). Ein weiteres wichtiges Merkmal einer posttraumatischen Belastungsstörung ist das bewusste Vermeiden von Aktivitäten, Situationen, Personen, Gedanken oder Gesprächen, die mit dem Trauma assoziiert sind, aus Angst davor, Erinnerungen an das Trauma könnten wachgerufen werden. Des Weiteren zeigen sich Symptome von Übererregtheit, wie z.B. Probleme ein- oder durchzuschlafen, Reizbarkeit oder Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, übermäßige Wachsamkeit oder übermäßige Schreckhaftigkeit, die vor dem Trauma nicht vorhanden waren.
Die Symptome müssen länger als einen Monat anhalten und innerhalb von sechs Monaten nach dem Trauma auftreten, um die Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung stellen zu können. Tritt die Symptomatik erst nach mehr als sechs Monaten auf, kann eine „wahrscheinliche“ Diagnose gestellt werden, wenn das klinische Bild typisch ist und keine andere Diagnose, wie z.B. eine Depression oder Angststörung, gestellt werden kann.
Häufig berichten Personen mit posttraumatischer Belastungsstörung von belastenden Schuldgefühlen, selbst überlebt zu haben, während andere Personen verstorben sind. Das Vermeidungsverhalten der Betroffenen kann weitreichende Folgen im sozialen und beruflichen Bereich haben, wie z.B. Eheprobleme oder den Verlust des Arbeitsplatzes. Wenn das belastende Erlebnis durch Menschen verursacht wurde (z.B. Missbrauchserfahrungen in der Kindheit oder häusliche Gewalt), finden sich häufig Symptome wie emotionale Abgestumpftheit, selbstschädigendes oder impulsives Verhalten, dissoziative Symptome, körperliche Beschwerden, das Gefühl der Unzulänglichkeit, Verzweiflung, Schamgefühle, Zerstörung des Weltbildes bzw. Verlust zuvor bewahrter Überzeugungen, Feindseligkeit, sozialer Rückzug, ständiges Gefühl einer Bedrohung ausgesetzt zu sein, Probleme in sozialen Beziehungen und eine Persönlichkeitsveränderung.
Eine posttraumatische Belastungsstörung stellt einen Risikofaktor dar, an einer Depression, einer Abhängigkeitserkrankung, einer Angststörung, einer Zwangsstörung oder einer bipolaren Störung zu erkranken.
Weitere Informationen zu den verschiedenen psychischen Erkrankungen finden Sie im Wissensbereich auf psycheplus.
Verlauf
Eine posttraumatische Belastungsstörung kann prinzipiell in jedem Alter (einschließlich der Kindheit) auftreten. Im Normalfall zeigen sich erste Symptome innerhalb der ersten drei Monate nach dem traumatischen Erlebnis, es kommt jedoch auch vor, dass die Symptome um Monate oder Jahre verzögert auftreten. Meist erfüllt die anfängliche Reaktion auf das Trauma die Kriterien einer akuten Belastungsreaktion bzw. akuten Belastungsstörung.
Die Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung vergehen in der Hälfte der Fälle innerhalb von drei Monaten wieder, während bei vielen anderen die Symptome über ein Jahr nach dem Trauma bestehen bleiben. Das Beschwerdebild kann sich jedoch in dieser Zeit verändern und in der Schwere und Ausprägung wechseln. Durch Erinnerungen an das Trauma, zusätzliche Belastungsfaktoren oder erneute traumatische Erlebnisse, kann sich die Symptomatik verschlechtern bzw. wieder aufleben.
Zahlen
Studien in den Vereinigten Staaten ergaben für Erwachsene eine Wahrscheinlichkeit von 8% einmal im Leben an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken. Risikogruppen mit höchsten Raten zwischen einem Drittel bis hin zu der Hälfte der Betroffenen sind Opfer von Vergewaltigungen, Militäreinsätzen, Gefangenschaft, Internierung sowie Völkermord.
Subtypen
Bei diesem Störungsbild werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Eine posttraumatische Belastungsstörung bedarf einer speziellen Trauma-Therapie, die idealerweise frühzeitig durchgeführt wird. Als hilfreich hat sich die Expositions- bzw. Konfrontationstherapie erwiesen. Dabei wird der Therapeut den Patienten langsam und behutsam in seiner Vorstellung an das traumatische Erlebnis heranführen. Der Patient soll das Erlebte gedanklich rekonstruieren und seine Gefühle, Erinnerungen und Vorstellungen in Worte fassen. Durch diese Auseinandersetzung kann der Patient das Ereignis aufarbeiten und sich von seinen belastenden Emotionen distanzieren. Mit kognitiven Verfahren wird zusätzlich versucht, die schädlichen Gedankenmuster des Patienten (wie eine Übergeneralisierung einer möglichen Gefährdung) zu verändern, um das Vermeidungsverhalten zu reduzieren und die ständige Angst und Übererregtheit zu vermindern.
Eine speziell für die Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung entwickelte Therapie ist das Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). Die sogenannte „bilaterale Stimulation“ ist dabei der zentrale Technik dieser Therapieform. Dabei soll sich der Patient auf eine besonders belastende Phase seines traumatischen Erlebnisses gedanklich konzentrieren, während der Therapeut ihn mit langsamen Fingerbewegungen gleichzeitig zu rhythmischen Augenbewegungen anleitet. Dadurch wird bei vielen Betroffenen die Angst, die durch die Erinnerungen an das Trauma hervorgerufen wird, reduziert und die Erinnerungen können in die Gedächtnisstrukturen überführt werden.
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
Pseudoanfall
Ein Pseudoanfall ist scheinbar epileptischer Anfall, der nicht auf die Krankheit Epilepsie zurückzuführen ist, sondern der psychische Ursachen hat.
Psychoedukation
Psychoedukation ist eine Schulung für psychisch erkrankte Menschen und deren Angehörige. Dabei wird versucht den Betroffenen die wichtigsten Informationen über die Erkrankung und die entsprechende Behandlungsmaßnahmen in verständlicher Weise näher zu bringen. Der Begriff setzt sich aus „Psychotherapie“ und „Edukation“ zusammen und kommt aus dem englisch-amerikanischen Sprachgebrauch.
Psychotrope Substanzen
Psychotrope Substanzen bezeichnen alle Stoffe, die Rauschzustände hervorrufen und damit Einfluss auf die Psyche und die Wahrnehmung haben. Hierunter zählen u.a. Alkohol, Cannabis, Heroin, Kokain und Amphetamine. Alle diese Stoffe haben ein hohes Suchtpotential.