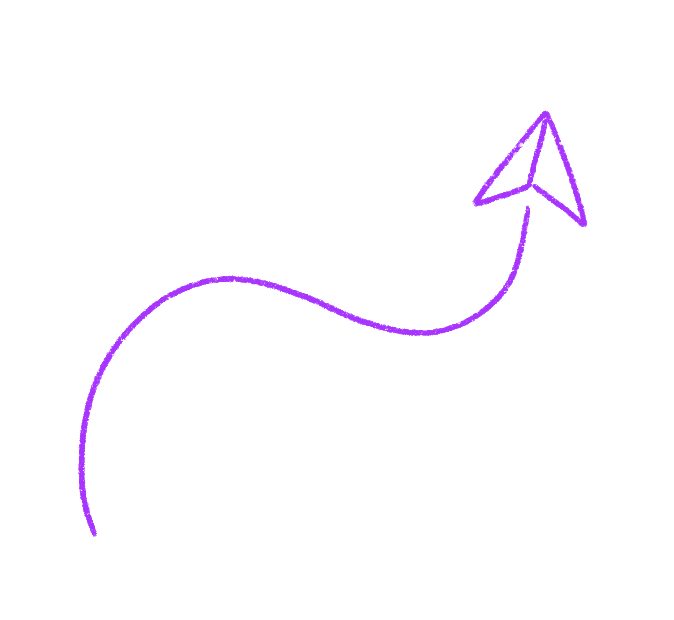Generalisierte Angststörung
Merkmale
Das wesentliche Merkmal der generalisierten Angststörung sind generalisierte, anhaltende Sorgen und Befürchtungen in Bezug auf verschiedene allgemeine oder besondere Lebensumstände, Ereignisse oder Tätigkeiten, wie z.B. die Sorge darüber, dass jemandem aus der Familie etwas zustoßen könnte oder unbegründete Geldsorgen. Die Angst muss über einen längeren Zeitraum hinweg bestehen (sie kann jedoch in ihrer Intensität schwanken). Dem Betroffenen fällt es meist sehr schwer seine Sorgen und Befürchtungen zu kontrollieren und er kann sich meist nur für kurze Zeit davon ablenken.
Die generalisierte Angststörung varriert in ihrer Einzelsymptomatik von Person zu Person, typischerweise äußert sich die Angst jedoch in folgenden Beschwerden:
- motorische Spannung
- körperliche Unruhe
- Nervosität
- Konzentrationsprobleme
- Kopf- und Muskelschmerzen
- Zittern
- Unfähigkeit sich zu entspannen
- leichte Ermüdbarkeit
- Schwitzen
- starkes Herzklopfen
- Oberbauchbeschwerden
- Schwindelgefühle
- Mundtrockenheit
- übermäßige Schreckhaftigkeit
- Schlafprobleme
- Reizbarkeit
Betroffene empfinden ihre Sorgen nicht immer als übertrieben, leiden aber darunter, dass sie die Sorgen nicht kontrollieren können und deshalb gewisse Beeinträchtigungen im familiären oder beruflichen Kontext erleben. Die ständigen Grübeleien machen es für den Betroffenen schwierig, sich auf bevorstehende Aufgaben zu konzentrieren. Das Ausmaß der Sorge ist im Vergleich zu der Wahrscheinlichkeit, dass die befürchteten Ereignisse wirklich geschehen, deutlich übertrieben. Betroffene sorgen sich häufig über ganz alltägliche Umstände, wie z.B. die Gesundheit der Familie, Finanzen, Beruf, oder gar Kleinigkeiten, wie den Haushalt, Verspätungen oder Reparaturen.
Tritt eine generalisierte Angststörung bereits im Kindesalter auf, kreisen die Sorgen des betroffenen Kindes häufig um die eigene Kompetenz und die Qualität seiner Leistungen. Die generalisierte Angststörung tritt häufig in Kombination mit einer affektiven Störung (z.B. Depression), einer anderen Angststörung sowie Störungen im Zusammenhang mit psychotropen Substanzen auf.
Weitere Informationen zu verschiedenen psychischen Erkrankungen finden Sie im Wissensbereich auf psycheplus.
Verlauf
Meist liegt der Beginn der generalisierten Angststörung in der Kindheit oder Adoleszenz, ein Beginn nach dem 20. Lebensjahr ist jedoch nicht außergewöhnlich. Viele Betroffene berichten, dass sie schon als Kinder oft ängstlich und nervös waren. Ohne Behandlung bleibt eine generalisierte Angststörung meist über mehrere Jahre bzw. Jahrzehnte bestehen. Die Erkrankung nimmt also einen chronischen Verlauf, die Intensität der Beeinträchtigung kann jedoch durchaus schwanken. Gerade in belastenden Lebenssituationen kann sich die Symptomatik verschlechtern. Grundsätzlich ist die Beeinträchtigung im sozialen und beruflichen Bereich nicht so gravierend wie bei anderen Angststörungen.
Zahlen generalisierte Angststörung
Die Wahrscheinlichkeit im Laufe seines Lebens an einer generalisierten Angststörung zu erkranken beträgt ca. 5%. Da bei der generalisierten Angststörung die Abgrenzung zu normaler Angst besonders schwierig ist, gibt es verschiedene Angaben zur Prävalenz und kaum verlässliche Zahlen. Bei einer breiten Definition werden sogar Zahlen bis zu 8% angegeben. In Kliniken, die hauptsächlich Angststörungen behandeln, haben bis zu 25% der Patienten eine generalisierte Angststörung als Erst- oder Zweitdiagnose.
Die generalisierte Angststörung findet sich bei Frauen häufiger als bei Männern. In epidemiologischen Studien liegt der Anteil von Frauen bei etwa 2/3. In klinischen Einrichtungen sind etwa 55- 60% der Patienten, die an einer generalisierten Angststörung erkrankt sind, weiblich.
Subtypen
Bei diesem Störungsbild werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Kognitive Verhaltenstherapie
Bei der generalisierten Angststörung haben sich besonders Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie als hilfreich erwiesen. Mit den kognitiven Verfahren versucht der Therapeut eingefahrene Gedankenmuster des Patienten zu korrigieren. Dem Patienten wird verständlich gemacht, welche Gedanken dazu beitragen, dass die Angst entsteht, aufrechterhalten bleibt und sich weiter verstärkt. Die Therapie kann als Einzel- oder auch Gruppentherapie stattfinden.
Expositionstechniken
Zusätzlich können Expositions- bzw. Konfrontationstechniken bei der generalisierten Angststörung eingesetzt werden. Der Patient muss dabei zunächst genau beschreiben, wodurch seine Sorgen ausgelöst werden, worum es bei den Sorgen geht, was sie aufrechterhält oder verstärkt und wann er angstfreie Phasen hat. Dann soll sich der Patient ganz bewusst mit seinen Sorgen auseinandersetzen und seine Befürchtungen und Ängste zu Ende denken ohne sich abzulenken, bestimmte Gedanken zu vermeiden oder sich ständig bei Anderen rückzuversichern. Auch Situationen, die der Patient normalerweise vermeidet, wie z.B. seine Kinder alleine nach draußen lassen, sollen zugelassen werden und durchlebt werden, wodurch der Patient genau wahrnehmen soll, welche Gefühle und körperlichen Empfindungen mit seinen Sorgen verbunden sind. Durch die Konfrontation verlieren diese mit der Zeit ihre Bedrohlichkeit und die Angst, wie auch die körperlichen Symptome (Unruhe, Verspannungen, etc.) lassen nach.
Entspannungsverfahren
In Kombination mit verhaltenstherapeutischen Methoden werden bei der generalisierten Angststörung häufig Entspannungsverfahren angewendet, da der Zustand der Entspannung Angstgefühle ausschließt. Die bekanntesten Verfahren sind die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, das Autogene Training, sowie Biofeedback.
Tiefenpsychologisch orientierte Therapie
In einer tiefenpsychologisch orientierten Therapie versucht der Therapeut gemeinsam mit dem Patienten herauszufinden, welcher unbewusste Konflikt der Angstsymptomatik zugrunde liegt. Häufig lässt sich bei Patienten mit einer Angststörung, wie der generalisierten Angststörung, ein ambivalent erlebter Trennungskonflikt finden und das bedeutet, es bestehen beispielsweise gleichzeitig Abhängigkeitsgefühle und Aggressionen gegenüber der Mutter oder dem Partner. Es kann jedoch auch bei den aufdeckenden Verfahren zunächst wichtig sein, die Angstbewältigungsmöglichkeiten des Patienten zu stärken. Eine tiefenpsychologische Therapie dauert in der Regel länger als eine Verhaltenstherapie und wird bis zu mehreren Jahren kontinuierlich angewandt.
Gesteigertes Sexuelles Verlangen
Merkmale
Personen, die unter dem Störungsbild mit „gesteigertes sexuelles Verlangen“ leiden, zeigen ein wiederholt auftretendes oder dauerhaftes Bedürfnis nach sexuellen Aktivitäten, welches das sexuelle Verlangen ihrer Mitmenschen deutlich übersteigt. Eine Unangemessenheit des sexuellen Verlangens ist jedoch schwer zu bestimmen, da man nicht wirklich festlegen kann, ab wann sexuelle Gedanken oder Handlungen zu häufig sind und damit nicht mehr in den Normalbereich fallen. Viele Sexualwissenschaftler und Sexualtherapeuten lehnen deshalb die Diagnose dieses Störungsbildes ab. Andere hingegen definieren Menschen dann als „sexabhängig“, wenn sie innerhalb von 6 Monaten mindestens 7 Orgasmen in der Woche haben und sich täglich ein bis zwei Stunden mit sexuellen Themen beschäftigen.
Personen mit einem gesteigerten sexuellen Verlangen berichten von einem nicht mehr zu kontrollierenden Konsum von Pornografie oder Telefonsex. Etwa mit der Folge von übermäßiger Masturbation und häufigen Sexualkontakten (Promiskuität). Viele beschreiben es als eine Art Sucht, von der sie besessen sind und machtlos gegenüberstehen. Dennoch erfahren viele kaum oder keine ausreichende Befriedigung bei ihren sexuellen Handlungen. Selbst dann nicht, wenn sie z.B. mehrmals täglich einen Orgasmus erleben. Bei Frauen wird im Zusammenhang mit gesteigertem sexuellem Verlangen auch häufig von Nymphomanie und bei Männern von Satyriasis oder Donjuanismus gesprochen.
Damit wirklich von einer Störung mit gesteigertem sexuellem Verlangen gesprochen werden kann, müssen die Betroffenen deutlich unter den Symptomen der sexuellen Funktionsstörung leiden, da diese entweder dauerhaft oder wiederholt auftreten. Des Weiteren können die exzessiven sexuellen Fantasien und Verhaltensweisen auch einige Probleme mit sich bringen, wie z.B. Unzufriedenheit in der Paarbeziehung oder Vernachlässigung von Familie, Beruf und sexfreien sozialen Kontakten.
Gesteigertes Sexuelles Verlangen – Verlauf
psycheplus liegen derzeit keine fundierten Beschreibungen zum Störungsverlauf des gesteigerten sexuellen Verlangens vor.
Zahlen
Die Befundlage zu den sexuellen Funktionsstörungen gestaltet sich als äußerst dürftig. Die Daten, die zur Prävalenz der einzelnen Störungen vorliegen, weisen enorme Unterschiede (Variabilität) auf, da sie entweder mit verschiedenen Verfahren erhoben wurden, verschiedene Definitionen der Störungen verwendeten oder Stichproben mit unterschiedlichen Merkmalen miteinbezogen. Auf Grund dessen liegen bis zum heutigen Zeitpunkt keine genaueren Daten zum gesteigerten sexuellen Verlangen vor. Allerdings ist bekannt, dass Männer häufiger von der Störung mit gesteigertem sexuellem Verlangen betroffen sind als Frauen.
Subtypen
Bei dem Störungsbild mit gesteigertem sexuellem Verlangen werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Personen mit gesteigertem sexuellem Verlangen finden häufig in Selbsthilfegruppen Anschluss und Hilfe. Sie können sich mit ebenfalls Betroffenen austauschen und Lösungsmöglichkeiten gemeinsam erarbeiten.
In der Therapie der Störung mit gesteigertem sexuellem Verlangen wird in der Regel eine Kombination verschiedener Techniken eingesetzt. Zum Beispiel soll der Patient neben der Therapie ein Lusttagebuch führen, indem er vermerkt, wann und in welchen Situationen er sexuelle Lust verspürt. Um die stimulierenden Gedanken immer weiter zu reduzieren wird der Gebrauch von Büchern, Zeitschriften, Filmen und Websites mit sexuellem Inhalt mit der Zeit immer mehr eingeschränkt.