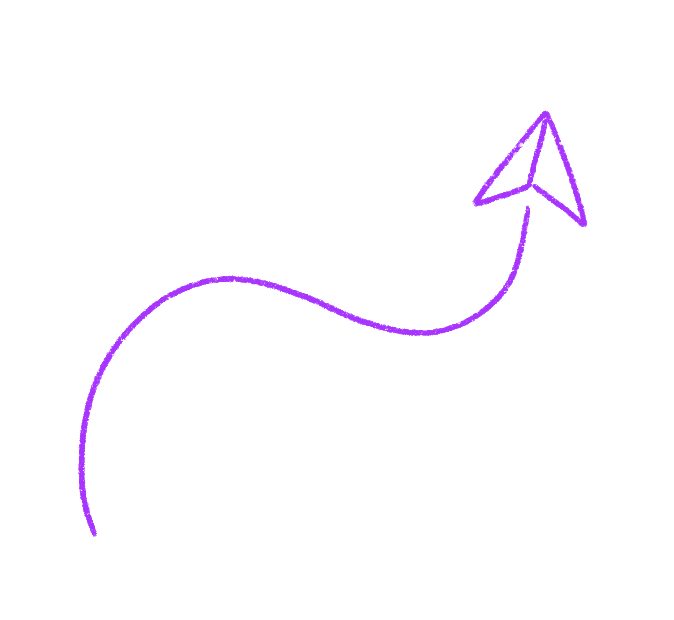Einzel- oder Gruppensetting
Beratungs- oder Therapieangebote einzeln oder in der Gruppe.
Ejaculatio Praecox – vorzeitiger Samenerguss
Merkmale
Bei Männern, die unter einem Ejaculatio Praecox leiden, tritt vorzeitiger Samenerguss unkontrolliert bzw. frühzeitig also bereits nach einer minimalen sexuellen Stimulation bzw. vor, während oder kurz nach einer Vereinigung auf. Aber auf jeden Fall noch, bevor sie es selbst möchten. Bei der schweren Form kann eine Ejakulation noch bevor es zu einer Erektion gekommen ist bzw. noch vor einer Penetration einsetzen. Damit ein Ejaculatio Praecox sicher bestimmt werden kann, sollte die allgemeine sexuelle Erfahrung und die sexuelle Erfahrung mit dem Partner bzw. der Partnerin, die derzeitige Anzahl sexueller Kontakte und das Alter berücksichtigt werden, sowie die mögliche beeinträchtigende Wirkung von Substanzen (z.B. Entzugserscheinung von Opiaten). Zudem müssen Männer mit einem Ejaculatio Praecox unter den Symptomen der Störung deutlich leiden bzw. sollte das frühzeitige Ejakulieren zwischenmenschliche Probleme (in bestehenden Beziehungen, aber auch bei alleinlebenden Männern) mit sich bringen.
Verlauf
Die Dauer des Geschlechtsverkehrs hat sich in den letzten Jahrzehnten gesteigert und damit auch die Anzahl derer, die an Ejaculatio Praecox leiden. Das Problem betrifft hauptsächlich jüngere Männer. Die Mehrzahl der Betroffenen ist unter 30 Jahren.
Zahlen
Die Befundlage zu den sexuellen Funktionsstörungen gestaltet sich als äußerst dürftig. Die Daten, die zur Prävalenz der einzelnen sexuellen Dysfunktionen vorliegen, weisen enorme Unterschiede (Variabilität) auf, da sie entweder mit verschiedenen Verfahren erhoben wurden, verschiedene Definitionen der Störungen verwendeten oder Stichproben mit unterschiedlichen Merkmalen miteinbezogen.
Eine amerikanische Studie, die Personen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren befragte, liefert eine Prävalenz für einen Ejaculatio Praecox von 27%.
Subtypen Ejaculatio Praecox
Bei allen sexuellen Funktionsstörungen wird hinsichtlich dem Anfangspunkt der Störung, den Umständen, innerhalb derer die Störung vorkommt, und den Ursachen für die Störung unterschieden.
Die frühzeitige Ejakulation gilt als „lebenslang“, wenn die sexuelle Funktionsstörung mit der geschlechtlichen Reife begonnen hat. Der Ejaculatio Praecox gilt als „erworben“, wenn er nach einem Zeitraum normaler sexueller Betätigung ihren Anfang genommen hat.
Der Ejaculatio Praecox kann auch mehrere verschiedene Situationen, Partner oder Arten der sexuellen Erregung betreffen und damit als „generalisiert“ bezeichnet werden. Er kann aber auch nur eine Situation, einen Partner oder eine Art der Stimulation betreffen und somit als „situativ“ gelten.
Der Ejaculatio Praecox kann sowohl durch psychische Faktoren alleine als auch durch psychische und körperliche Faktoren ausgelöst werden.
Therapien
Die unterschiedlichen Therapieverfahren versuchen auf Grund ihres unterschiedlichen Ursachenverständnisses, die sexuellen Funktionsstörungen auf unterschiedliche Weise zu behandeln.
Psychoanalyse
In der Psychoanalyse geht man davon aus, dass Personen mit einer sexuellen Funktionsstörung in ihrer Entwicklung bei einer der psychosexuellen Phasen (Freud unterscheidete die orale, anale, latenz und genitale Phase) zurückgeblieben sind. So soll der Patient in der Beziehung zum Analytiker alle Phasen der Kindheit nochmals durchleben, aber diesmal erfolgreich. Dadurch soll eine tiefreichende Umstrukturierung der Persönlichkeit erreicht werden.
Verhaltenstherapie
In der Verhaltenstherapie kommen hauptsächlich Muskelentspannungsübungen und Methoden, wie die systematische Desensibilisierung zum Einsatz, um die vorherrschende Angst bei sexuellen Funktionsstörungen zu reduzieren.
Sexualtherapie
Die wohl bekannteste Behandlungsmethode bei sexuellen Funktionsstörungen ist die von William Masters und Virginia Johnson (1970), welche auch unter der Bezeichnung „Sexualtherapie“ bekannt wurde. Das achtstufige Verfahren beinhaltet kognitive, verhaltenstherapeutische sowie auch kommunikative Techniken und setzt direkt beim sexuellen Problem an. Innerhalb von ca. 15 bis 20 Therapiestunden (Kurzzeittherapie) werden folgende standardmäßig angewandt:
- Diagnostik und Problemanalyse: Zuerst werden mögliche organische Probleme in einer medizinischen Untersuchung abgeklärt bzw. ausgeschlossen. Des Weiteren wird die bisherige sexuelle Erfahrung erfragt, um mögliche Ursachen und aufrechterhaltende Faktoren aufzudecken. Es kann dazu kommen, dass auch der Partner aktiv in die Therapie miteinbezogen wird.
- Beiderseitige Verantwortlichkeit: Der Patient/die Patienten sollen zur Einsicht gelangen, dass immer beide Partner zum sexuellen Problem beitragen, egal bei wem die Störung auftritt. Somit ist es immer hilfreicher, wenn beide die Therapie in Angriff nehmen.
- Information über Sexualität: Mit Hilfe von Gesprächen, Büchern und Videos versucht der Therapeut schließlich dem Patienten das Wissen zu Anatomie und Physiologie der sexuellen Reaktionen näherzubringen.
- Einstellungsänderung: In den nächsten Schritten sollen die Patienten ihre Einstellungen zur Sexualität, die augenscheinlich zur Hemmung der sexuellen Erregung und Lust beitragen, äußern. Der Therapeut versucht diese Einstellungen durch bestimmte Übungen zu verändern.
- Beseitigung von Leistungsangst und der Beobachterrolle: Vor allem bei Männern scheinen diese Faktoren eine Erregung zu erschweren und bestimmte sexuelle Funktionsstörungen aufrechtzuerhalten. Mit Hilfe von Techniken, wie „sensorische Fokussierung“ und „nicht forderndes Lustspenden“, sollen zunächst sexuelle Begegnungen auf Umarmungen, Küssen und Massagen des Körpers (ohne das Berühren von Brust oder Intimbereich) reduziert werden. Erst nach und nach werden weitere Handlungen erlaubt und somit die sexuelle Lust allmählich gesteigert.
- Verbesserung der sexuellen Kommunikationstechniken: Zudem übt der Therapeut mit den Patienten neue Strategien ein, wie Patienten auch während dem Geschlechtsakt miteinander kommunizieren können. Bei der sensorischen Fokussierung soll der Patient z.B. die Hand seines Partners führen. So kann er Geschwindigkeit, Druck und Ort der Liebkosungen und Streicheleinheiten bestimmen. Schließlich sollen verbale Hinweise immer positiv und informativ formuliert werden (sagen, was einem gefällt und dass es einem gefällt).
- Veränderung eines möglichen destruktiven Lebensstils und beeinträchtigender partnerschaftlicher Interaktionen. Natürlich werden in der Therapie auch die Lebensumstände des Patienten berücksichtigt und – wenn möglich – bearbeitet.
- Bearbeitung körperlicher und medizinischer Faktoren: Bereits zu Beginn der Therapie werden mögliche Faktoren, wie Krankheiten, Verletzungen, Medikamenteneinnahmen oder möglicher Substanzmissbrauch, die einen Einfluss auf die Ausbildung einer sexuellen Funktionsstörung haben können, abgeklärt.
Im Speziellen können bei Ejaculatio Praecox vor allem verhaltenstherapeutische Techniken helfen. In der Therapie werden Strategien eingeübt, die die Kontrollierbarkeit über eine Ejakulation trainieren sollen, wie z.B. das „Stop-Start“ oder „Pause“-Verfahren. Hierbei wird der Penis mit der Hand erigiert. Sobald eine angemessene Erektion erreicht ist, wird eine Pause eingelegt bis die Erektion zurückgegangen ist. Erst nach mehrmaligen Wiederholungen darf der Mann ejakulieren. Später kommen das Eindringen und die rhythmischen Bewegungen hinzu, bei denen die Ejakulation auch möglichst lange zurückgehalten werden soll. Auf diese Weise lernen betroffene Männer ihre Ejakulation zeitlich immer weiter hinauszuzögern. Des Weiteren werden auch serotonerge, antidepressive Medikamente bei der Behandlung des Ejaculatio Praecox eingesetzt.
Elektrolythaushalt
Elektrolyte sind Stoffe, die unterschiedliche chemische Elemente enthalten. Eine Vielzahl von Elektrolyten, der Elektrolythaushalt, sorgt im Körper dafür, dass der Flüssigkeits- und Wasserhaushalt im Gleichgewicht bleibt und dass Muskel-und Nervenzellen aktiv bleiben.
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ)
Merkmale
Beim Borderline-Typ sind wie beim impulsiven Typ der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung einige Merkmale emotionaler Instabilität und geringer Selbstkontrolle vorhanden. Zusätzlich haben Betroffene ein unklares und gestörtes Selbstbild, sowie wechselnde und unklare Lebensziele und Präferenzen, einschließlich der sexuellen Orientierung. Darüber hinaus quälen Personen mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung Gefühle der inneren Leere und Langeweile.
Borderliner gehen zwar intensive Beziehungen ein, diese sind jedoch sehr instabil. Beziehungspartner oder Bezugspersonen werden meist zu Beginn stark idealisiert. Personen mit dem Borderline-Typ geben sehr viel, wollen viel gemeinsame Zeit verbringen und teilen schnell intime Details mit. Die anfängliche Idealisierung kann jedoch in eine massive Entwertung umschlagen. Häufig wird der Partner oder die Bezugsperson angeklagt, sich nicht genug zu kümmern oder nicht genug zu geben. Diese plötzliche Änderung der Einstellung bzw. Sichtweise und das ambivalente Verhalten anderen gegenüber ist typisch für eine Borderline-Störung und hat oft verheerende Folgen für die Beziehung.
Oftmals ist die Beziehung durch einen Wechsel von Anklammern und Verlustängsten und plötzlichem Wegstoßen und Entwerten des Partners gekennzeichnet. Personen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) bemühen sich über alle Maße vermutetes oder tatsächliches Verlassenwerden zu vermeiden. Selbst, wenn sie nur mit einer zeitlich begrenzten Trennung oder Planänderung konfrontiert werden, reagieren sie mit Verlustängsten und unangemessenem Ärger und Wut. Im Zusammenhang mit diesen Ängsten steht eine Unfähigkeit, alleine zu sein, bzw. das Verlangen, andere Personen um sich zu haben. Die Bemühungen nicht verlassen zu werden gehen nicht selten mit Selbstmordversuchen, -androhungen oder -andeutungen oder auch Selbstverletzungsverhalten einher, wobei die Selbstverletzungen ein Gefühl der Entlastung bewirken, da Borderliner dadurch spüren, dass sie fühlen können und „noch da sind“ oder das Gefühl „schlecht“ zu sein büßen können.
Folgen
Ihre Impulsivität kann sich darüber hinaus in weiteren, möglicherweise selbstschädigenden Aktivitäten, wie Glücksspielen, übermäßigen Geldausgaben, Substanzmissbrauch, risikoreichem Sexualverhalten, rücksichtlosem Fahren oder Essanfällen zeigen. Das eigene Selbstbild der Borderliner ist gestört oder unklar und sie neigen dazu, ihre Ziele, Wertvorstellungen oder Berufswünsche plötzlich und drastisch zu wechseln. Auch die sexuelle Orientierung oder die Art der Freunde können sich unvorhergesehen verändern. Unter starker Belastung (insbesondere bei erwartetem oder tatsächlichem Verlassenwerden) können Personen mit einer Borderline-Störung dissoziative Symptome, wie Depersonalisation oder paranoide Vorstellungen entwickeln, die jedoch nicht stark oder nur vorübergehend sind.
Eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) tritt häufig in Kombination mit affektiven Störungen (z.B. einer Depression), Substanzmissbrauch bzw. -abhängigkeit, Essstörungen (vor allem Bulimia Nervosa), einer Posttraumatischen Belastungsstörung und einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung sowie anderen Persönlichkeitsstörungen auf.
Informieren Sie sich über weitere psychische Erkrankungen im Bereich Wissen auf psycheplus.
Verlauf
Die Borderline Persönlichkeitsstörung kann sehr variabel verlaufen. Meist zeigen sich die stärksten Beeinträchtigungen im frühen Erwachsenenalter und auch die Suizidgefährdung ist in dieser Zeit besonders hoch.
Personen mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ), die sich in Therapie befinden, zeigen meist eine Besserung der Symptome. Eine gewisse Impulsivität, schwankende Emotionalität und schwierige Beziehungsgestaltung bleiben jedoch meist bestehen. Ab dem mittleren Lebensalter scheinen viele Betroffene eine größere Stabilität in Beziehungen und dem Berufsleben zu erlangen.
Zahlen
Von einer Borderline Persönlichkeitsstörung sind etwa 2% der Allgemeinbevölkerung betroffen, wobei Frauen (70%) häufiger betroffen sind als Männer.
Subtypen
Bei dem Störungsbild emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
Eine Langzeittherapie kann bei der Borderline Persönlichkeitsstörung durchaus in einigen Fällen gewisse Erfolge zeigen. Therapeuten sehen sich jedoch mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass die Patienten dazu neigen, sie immer wieder zurückzustoßen und zu entwerten. Außerdem gestaltet sich das Ende der therapeutischen Beziehung oft als schwierig, da diese Situation bei den Borderlinern alte Verlustängste aufbrechen lässt. Mit verhaltenstherapeutischen Methoden wird versucht, dem Patienten durch Modelllernen andere Denkmuster und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen zu vermitteln.
Analytische Therapiemethoden konzentrieren sich bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) auf die Beziehungs- und Identitätsstörung des Patienten, wobei manche Therapeuten die verschiedenen Ansätze miteinander kombinieren.
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) wurde von der amerikanischen Psychologieprofessorin und Klinikleiterin Marsha M. Linehan speziell zur Behandlung der Borderline Persönlichkeitsstörung entwickelt. Diese Therapie verwendet neben Techniken aus der Verhaltenstherapie auch Methoden aus der humanistischen Therapie, der Körpertherapie, der Gestalttherapie, der Hypnosetherapie und Übungen aus dem Zen-Buddhismus. Die DBT kommt sowohl in der ambulanten als auch in der stationären Therapie zur Anwendung. Das Therapiemanual wurde auch auf verschiedene Patientengruppen, wie z.B. Jugendliche, Patienten mit Essstörungen oder Personen im Strafvollzug, hin modifiziert. Auch Fertigkeitentraining im Rahmen einer Gruppentherapie ist Teil der Dialektisch-Behavioralen Therapie.
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ)
Merkmale
Die emotional instabile Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ) ist durch ein impulsives Verhaltensmuster mit intensiven, instabilen Gefühlen und geringer Impulskontrolle gekennzeichnet, wobei Betroffene meist nicht über die Konsequenzen ihres Verhaltens nachdenken und nicht vorausschauend handeln. Insbesondere, wenn sie von anderen Personen Kritik für ihr Verhalten erfahren, können sie sehr aggressiv und mit Wutausbrüchen reagieren. Bei ihren Mitmenschen gelten impulsive Personen deshalb als launisch, aufbrausend und unberechenbarSie haben Schwierigkeiten, bei Enttäuschungen oder Frustration ihre Gefühle zu kontrollieren und verlieren daher schnell die Beherrschung. Darauf folgen oftmals Scham und Schuldgefühle.
Verlauf
psycheplus liegen derzeit keine Informationen über den Verlauf des emotional instabile Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ) vor. Für Informationen zum Borderline-Typ greifen Sie bitte auf den entsprechenden Abschnitt unter emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) zu.
Zahlen
psycheplus liegen derzeit keine Informationen über Prävalenzzahlen und Häufigkeiten der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ) vor. Für Informationen zum Borderline-Typ greifen Sie bitte auf den entsprechenden Abschnitt unter emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) zu.
Subtypen
Bei dem Störungsbild der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ) werden keine Subtypen unterschieden.
Therapie
psycheplus liegen derzeit keine Informationen über die Therapie der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung (impulsiver Typ) vor. Für Informationen zum Borderline-Typ greifen Sie bitte auf den entsprechenden Abschnitt unter emotional instabile Persönlichkeitsstörung (Borderline-Typ) zu.
Exekutive Funktionen
Exekutive Funktionen beschreiben „höhere“ kognitive Fähigkeiten, die der Selbstregulation und der zielgerichteten Handlungssteuerung eines Indivuduums in seiner Umwelt dienen. Dazu zählen u.a. das Setzen von Zielen, die Planung, die Aufmerksamkeitsregulierung und die Handlungsausführung.
Expositionstechnik
In einer Expositions– bzw. Konfrontationstherapie werden Personen, die unter Ängsten leiden, mit diesen angstauslösenden Situationen oder Objekten konfrontiert. Der Patient kann entweder schrittweise herangeführt werden oder direkt mit dem Reiz konfrontiert werden, der am meisten Angst auslöst (sogenanntes flooding). Ausserdem kann die Konfrontation zunächst „in sensu„, also in der Vorstellung sattfinden, oder „in vivo„, also im Feld (z.B. im Flugzeug bei Flugangst).